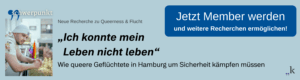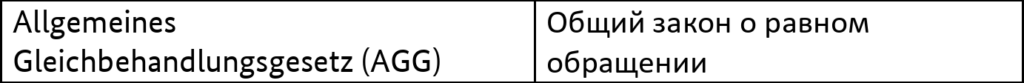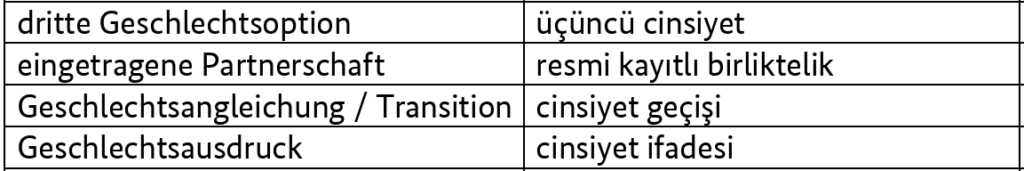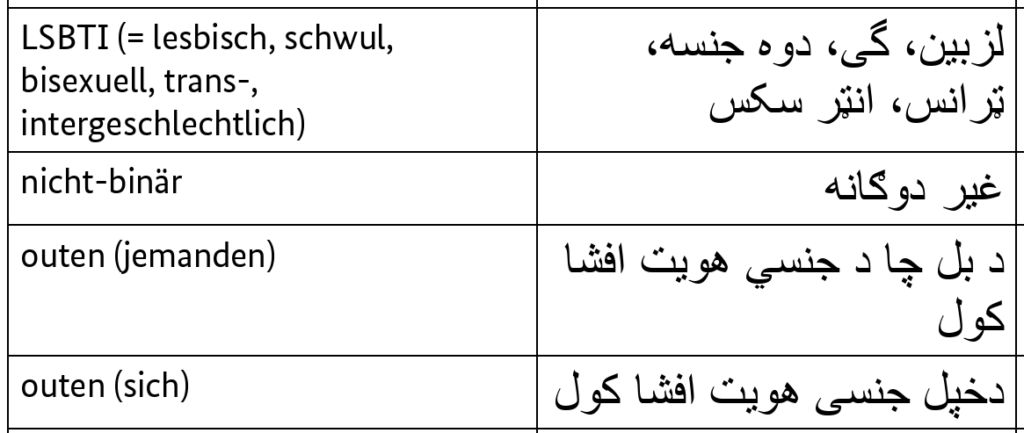Eine Regenbogenfahne weht auf einem Balkon im ersten Stock eines Hauses, im Stadtteil Jenfeld, am östlichen Stadtrand Hamburgs. Rot, orange, gelb, grün, blau, violett. Jede Farbe symbolisiert die Vielfalt der Geschlechter, sexuellen Orientierungen und Identitäten. Ein Symbol für die queere Community weltweit. Hier ist sie das einzige farbige Zeichen im Kontrast zu den weißen Wänden und den schwarz verglasten Balkonen der Häuser, die sich ähnlich aneinanderreihen. Hier, in der Wohnung im ersten Stock, in der die Fahne weht, lebt Abdelrahman Salem.
An einem Frühlingsnachmittag im März sitzt Salem auf dem Bett seines Mitbewohners Imran, dessen Zimmer auch als Wohnzimmer der Dreier-WG dient, und erzählt mit ruhiger Stimme von seinem Leben in seiner Heimatstadt Gizeh in Ägypten, wo er als schwuler Mann mit seiner Familie lebte. Nur seiner Mutter habe er sich anvertraut, sagt er, dass er schwul ist.
Wenn jemand lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* oder asexuell (LGBTQIA+) ist und verfolgt wird, ist das in Deutschland ein anerkannter Asylgrund – so sehen es die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention und der EU-Richtlinien vor. „Verfolgung“ im Sinne des Gesetzes bedeutet, dass aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität im Herkunftsland massive Gewalt, Tod, Haft oder andere Formen unmenschlicher Behandlung drohen.
Während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über Asylanträge entscheidet, kümmert sich die Kommunalverwaltung um die Unterbringung der Geflüchteten. In dem Fall von Salem ist das die Stadt Hamburg.
Auf der schwierigen Suche nach Schutz
Doch auch in den Sammelunterkünften hier in Deutschland werden queere Menschen, also Menschen, die der LGBTQIA+ Community angehören, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zur Zielscheibe von Diskriminierung und Gewalt – sei es durch das Personal oder durch andere Bewohner*innen. Deshalb haben sie das Recht, nach der Asylantragstellung in einer anderen Unterkunft untergebracht zu werden. So wie Salem heute. In einer Schutzwohngemeinschaft wegen besonderen Schutzbedarfs, wie es in der Sprache der Bürokratie heißt.
Wie diese Unterkünfte für queere Geflüchtete in der Praxis aussehen, ist Sache der Bundesländer mit jeweils eigenen Schutzkonzepten. In Hamburg befinden sich die Plätze für queere Geflüchtete in verschiedenen öffentlichen Unterkünften. Außerhalb ihrer WGs teilen sich dort die queeren Bewohner*innen den Eingang, die Flure und das Außengelände mit anderen Geflüchteten, die nicht queer sind und im selben Haus untergebracht sind. Dezentrale Unterkünfte heißen diese, im Gegensatz zu zentralen Unterkünften, also Unterkünften, die insgesamt nur von queeren Geflüchteten bewohnt werden. Zentrale Unterkünfte gibt es in Hamburg trotz diverser Bemühungen bisher nicht. Eine geplante Unterbringung in Winterhude wurde im Januar gekippt – die Adresse wurde öffentlich bekannt, Anwohner*innen beschwerten sich.
In den bestehenden dezentralen Unterkünften sind die queeren Bewohner*innen nicht immer sicher. Die Beratungsstelle für Flucht und Migration des Vereins Magnus-Hirschfeld-Centrum, eine Anlaufstelle für queere Menschen in Hamburg, verzeichnete 44 Fälle von Übergriffen, Beleidigungen und Anfeindungen im vergangenen Jahr, die sich gerade außerhalb dieser geschützten Wohngemeinschaften ereignet haben – das ist aber ein Problem, das nur diejenigen haben können, die überhaupt einen Platz in solchen Unterkünften bekommen.
Denn der Weg zu einer Schutzwohngemeinschaft gleicht einem steinigen Parcours, einem komplizierten Puzzle, das nur gelingen kann, wenn mehrere Bedingungen zusammenkommen: geschultes Personal in den Einrichtungen, vertrauliche Gespräche mit geeigneten Dolmetscher*innen, das Einbeziehen externer Beratungsstellen und letztendlich freie Plätze in den geschützten Unterkünften. Gelingt das in Hamburg? Kommt die Stadt ihrer Schutzverpflichtung gegenüber queeren Geflüchteten nach?
„Sie haben mich nicht ernst genommen“ – Salems Weg durch Europas Asylsystem
Mit seinem runden Gesicht und dem schüchternen Lächeln wirkt Salem mit seinen 27 Jahren noch sehr jung. Trotz aller Gewalterfahrungen. Trotz Gefängnis, Flucht, Suizidversuch.
Als Salem 2022 in Hamburg ankam, sei er bereits zweimal in Ägypten verhaftet worden. Polizisten hätten ihn verprügelt, weil er sich in einer Facebook-Gruppe über die Unfreiheit im Land beschwert habe, über die Situation der queeren Community, über die Homophobie.
Als er ankam, habe er bereits eine Schlauchbootfahrt von der Türkei nach Griechenland, eine illegalisierte Durchreise nach Nordeuropa und einen Aufenthalt in einer Geflüchtetenunterkunft in Polen hinter sich gehabt. Dort habe er dem Personal von seiner Homosexualität erzählt, sagt er. Dafür sei er von ihnen beschimpft und von anderen Bewohnern angegriffen worden.“Dann wurde ich in ein anderes Camp gebracht, in einen geschlossenen Raum”, sagt er, “da war ich allein, konnte aber nicht raus, wie im Gefängnis.”
Er habe versucht, sich das Leben zu nehmen, sei im Krankenhaus gelandet. Da ihm in Polen die Abschiebung nach Ägypten drohte, floh er weiter nach Deutschland.
Seit eineinhalb Jahren wartet Salem nun auf die Entscheidung über seinen Asylantrag. In Hamburg sollte Salem bleiben dürfen. Aufgrund seiner queeren Identität sollte eine sogenannte Dublin-Abschiebung, also eine Rückführung innerhalb der Europäischen Union, in seinem Fall nach Polen, nicht in Frage kommen. Das ist aktuell der Fall, wenn die Abschiebung eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Würde darstellt, so das nationale Abschiebungsverbot im Aufenthaltsgesetz.
In Hamburg bekam er erst einen Platz in einer Unterkunft in Farmsen-Berne, dann in Niendorf, dann in Harburg. Erst eine Sammelunterkunft, dann eine Sammelunterkunft und dann wieder eine Sammelunterkunft.
In Niendorf habe er dem Personal von seiner Homosexualität erzählt, nach einer anderen Unterkunft gefragt, sagt er. “Sie haben mich nicht ernst genommen”. Das Personal in den Hamburger Flüchtlingsunterkünften ist nicht immer geschult, was Gewalterfahrungen von queeren Geflüchteten und den Umgang damit angeht. Solche Schulungen werden zwar von dem Unternehmen Fördern und Wohnen als Träger der Unterkünfte angeboten, sind aber nicht verpflichtend.
In der nächsten Unterkunft in Harburg teilte sich Salem einen Container mit vier Zimmern mit sieben muslimischen Männern. Aus Angst vor möglichen Schikanen habe er seine queere Identität verheimlicht und sich als Muslim ausgegeben, mit ihnen fünfmal am Tag gebetet und im Ramadan gefastet. Er habe keinen Kontakt zu anderen queeren Menschen gehabt, sagt er. „Ich konnte mein Leben nicht leben.“

Salem erzählt seine Geschichte im Detail. Er wolle alles teilen, sagt er. Als sei er froh, endlich gesehen zu werden, sich endlich so zeigen zu können, wie er ist.
Im Internet habe er nach queeren Gruppen gesucht, nach Migrant*innenorganisationen, sagt Salem. So sei er auch auf die interkulturelle Beratungsstelle Lâle gestoßen. Die habe für ihn mit dem Hamburger Sozialamt eine Bleibe vermittelt. So bekam Salem im Januar 2024 von Fördern und Wohnen den Platz in seiner heutigen Wohngemeinschaft, in der die Regenbogenfahne weht.
Um zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen, braucht Salem eine Sondergenehmigung der Ausländerbehörde. Im vergangenen Jahr habe er viermal die Chance verpasst, eine Ausbildung zum Altenpfleger zu machen, sagt er. Die Ausländerbehörde habe immer zu spät reagiert. Die meiste Zeit verbringe Salem zuhause.
Queere Geflüchtete in Hamburg – eine Balance zwischen Sicherheit und Sichtbarkeit
In Hamburg leben derzeit ca. 46.000 Menschen in öffentlicher Unterbringung, davon 67 in den Schutzwohngemeinschaften – fünf Personen stehen nach offiziellen Angaben auf der Warteliste. Der tatsächliche Bedarf an Unterkünften für queere Geflüchtete ist weit höher. Das Unterbringungsproblem ist aber nicht nur ein Platzmangel.
Eine Regenbogenfahne hängt auch am Fenster des Lesbenvereins Intervention im Hamburger Karoviertel. In den Räumen bietet das Projekt Refugee Sisters*, ein Teil des Vereins, Beratung für lesbische und bisexuelle Frauen sowie nicht-binäre, inter*- und trans*Menschen an, die nach Hamburg geflohen sind. Darüber hinaus bietet der Verein Gruppentreffen, Workshops, Veranstaltungen — er ist ein Treffpunkt für eine ganze Community.
An einem Freitagmittag sitzt Alissa von Malachowski im Beratungsraum des Projekts. An der Wand reihen sich Bücher– unter anderem über Sexualität, Coming-out, Transidentität. An der Wand neben der Tür hängt ein Kopf eines Einhorns. Von Malachowski, 37, ist Psycholog*in und leitet seit 2020 Refugee Sisters*.

Aktuell begleitet von Malachowski etwa 30 Klient*innen. Dabei geht es um rechtliche Beratung und psychologische Unterstützung – vom Umgang mit dem Personal in den Unterkünften über den Asylantrag bis hin zur Vernetzung in der queeren Community Hamburgs. „Zugehörigkeit und sich verstanden fühlen sind immens wichtige Faktoren im Heilungsprozess nach – oft langjährigen – Gewalterfahrungen“, sagt von Malachowski.

Die sogenannte dezentrale Unterbringung, also queere Wohngemeinschaften in nicht-queeren Wohngebäuden, sei ein erster Schritt in diese Richtung, sagt von Malachowski. Darüber hinaus brauche die Stadt aber eine zentrale Unterkunft für queere Geflüchtete, in denen auch wirklich nur queere Personen leben. Was eine solche Unterkunft ausmacht?
Von Malachowski kann es genau beschreiben: Es müsste eine Unterkunft sein, die sogenannte Folgeplätze und Erstaufnahmeplätze für queere Geflüchtete anbietet, damit die Menschen vom ersten Tag des Asylverfahrens an Zugang zu Schutz haben. Es müsste queer-sensibles und spezifisch geschultes Personal vor Ort sein. Sicherheitspersonal, Dolmetscher*innen, Sozialarbeiter*innen. Es sollte ein leicht zugänglicher Ort in der Stadt sein, an dem die Menschen das Gefühl haben, Teil der Gesellschaft und Nachbarschaft zu sein. Dazuzugehören, ohne Angst haben zu müssen, angegriffen zu werden, sagt sie. „Es muss ein Ort sein, der diese schöne Balance zwischen Sicherheit und Sichtbarkeit schafft.“
Was aus der geplanten Unterkunft in Winterhude wurde
Für ein solches Wohngebäude, in dem nur queere Geflüchtete ein Zuhause finden, stehen Alissa von Malachowski sowie Vertreter*innen des Magnus-Hirschfeld-Centrums und der Hamburger Queer-Community seit Monaten im Austausch mit der verantwortlichen Behörde für Soziales. Ein regelmäßiger Dialog, den beide Seiten, Community und Behörde, zu schätzen sagen. Er sei jetzt wichtiger denn je geworden, nachdem die geplante zentrale Unterkunft in Hamburg-Winterhude im Januar endgültig gekippt wurde.
Gründe dafür gab es viele: Bereits in der Bezirksversammlung, die rechtlich notwendig war, um die Unterkunft errichten zu können, gab es erste kritische Stimmen. Dabei wurde auch die Adresse in der Sierichstraße öffentlich, die für eine Schutzeinrichtung eigentlich geheim bleiben soll. Auch Anwohner*innen, vertreten von einem Anwalt, sprachen sich gegen die Unterkunft für queere Geflüchtete aus.
Zudem hätte der Bauantrag für die neue Nutzung des Wohngebäudes aufgrund mehrerer baurechtlicher Einwände vom Bezirk nicht genehmigt werden dürfen – so die Behörde. Schließlich zog Fördern und Wohnen als Betreiberin der geplanten Unterkunft den Bauantrag im Januar 2025 zurück.
In einem Video-Call aus ihrem Büro wenige Tage später stellt Petra Lotzkat, Hamburgs Staatsrätin für Soziales, gleich zu Beginn klar: Sie wolle aus den Erfahrungen rund um die Sierichstraße die richtigen Schlüsse ziehen. Erstens: Eine öffentliche Diskussion über Standorte für besonders schutzbedürftige Geflüchtete sei nicht hilfreich.
Nun verfolge die Staatsrätin gemeinsam mit dem Unternehmen Fördern und Wohnen eine neue Strategie. Man habe auch eine neue mögliche Unterkunft gefunden und wolle die Nutzung nun peu à peu umwidmen, sagt Lotzkat. Das Gleiche sei auch an bestehenden Standorten möglich. „Immer wenn eine Wohnung frei wird, könnte sie mit queeren Bewohner*innen neu belegt werden, so dass dafür gar keine neue Genehmigung notwendig ist.“ So hoffe die Staatsrätin, bald die gleichen Wohnmöglichkeiten schaffen zu können, die in Winterhude nicht realisiert wurden.
Doch Petra Lotzkat ist am 7. Mai nach knapp sieben Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie sagt, sie werde alles so hinterlassen, dass die Unterbringung von queeren Geflüchteten auch von ihrer Nachfolgerin Funda Gür gut vorangebracht werden kann.

In der Wohnung im ersten Stock, am östlichen Stadtrand Hamburgs, in der die Fahne weht, wirkt Abdelrahman Salem entspannt, so wie er mit seinem Mitbewohner Imran, einem schwulen Mann aus dem Irak, auf dem Bett sitzt. Sie seien mit der Zeit Freunde geworden, sagt er, kochen gerne zusammen. Seit ein paar Wochen wohnen sie zu dritt, mit einem neuen Mitbewohner. Der sei aber nicht queer, erzählt Salem. Die beiden haben kein Problem mit ihm, sie fühlen sich trotzdem sicher zu Hause. Aber wie kann das sein? Ein Mensch außerhalb der queeren Community in einer queeren Schutzwohngemeinschaft? Ein weiterer Fehler im System.
___________________________________________________________
Schließe jetzt eine Membership ab!
Damit wir auch in Zukunft solche Recherchen umsetzen und weiterhin einen Raum für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte schaffen können, sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.