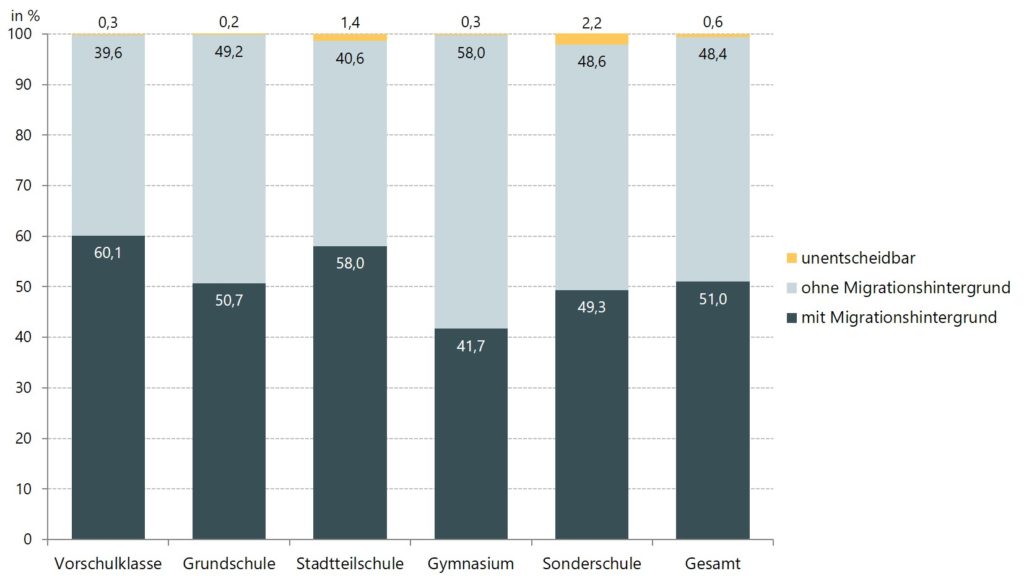Was an dem Abend geschah
Es ist circa 20:30 Uhr am Donnerstag des 19. November, 2020, als Joao Alberto Freitas, 40 Jahre alt, zusammen mit seiner Frau Milena, den Supermarkt Carrefour in Porto Alegre, der südlichsten Hauptstadt Brasiliens, betritt. Es ist der Vorabend des „Tags des Schwarzen Bewusstseins“, ein Feiertag in Brasilien. Joao Alberto kann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass er diesen Abend nicht überleben wird.
Aus ungeklärter Ursache entsteht eine Diskussion zwischen Joao und einer Mitarbeiterin des Supermarktes. Später sagt sie der Polizei „er wirkte extrem aufgeregt, ja wütend“, auch wenn es bisher keine Belege für diese Aussage gibt. Sie bittet zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes um Hilfe, auch das ist nichts Außergewöhnliches in vielen brasilianischen Läden. Zwei Männer nähern sich Joao und zerren ihn weg, in Richtung des großen Parkplatzes. Dort hält einer Joao fest, während der andere auf Joao immer wieder einschlägt. Fünf Minuten lang.
Ein Land demonstriert
Während der Aggression hat Joao seine Frau Milena um Hilfe gebeten, es war aber alles zu spät. Einer der Sicherheitskräfte kniete sich auf den Hals des Opfers, bis es sich nicht mehr bewegte. Beide Sicherheitsmänner waren weiß. Joao war schwarz. Unzählige Zeugen sahen das Geschehen und taten das, was in Brasilien üblich ist: nichts.
Einige filmten das Ganze mit ihren Smartphones. Kurze Zeit später waren diese Bilder auf verschiedenen Medien zu sehen. Die Täter, Giovane, ein Militärpolizist ohne Genehmigung für die Tätigkeit als Sicherheitskraft. Der andere, Magno, besaß zwar einen entsprechenden Schein, dieser war aber abgelaufen. Beide sagten später bei ihrer Vernehmung, „dass sie wohl übertrieben hätten“.
Die gewalttätigen Reaktionen auf den Straßen erfolgten wenige Stunden später, zuerst in Porto Alegre und danach in einigen Hauptstädte Brasiliens. Vielleicht weil die brutale Tat am Abend vor dem Tag des Schwarzen Bewusstseins geschah oder vielleicht auch, weil das Thema Rassismus momentan zum Alltag in verschiedenen Ländern gehört. Es war Fall das erste Mal, dass so viele spontane Demonstrationen gegen Rassismus fast zeitgleich in Brasilien stattfanden und noch ein paar Tage nach dem Mord an Joao anhielten.
Brasilien verleugnet seinen Rassismus
Rassismus, vor allem gegen Schwarze und Indigene wird von breiten Schichten der Bevölkerung verleugnet. So auch der brasilianischer Vize-Präsident, Hamilton Mourao: „Es ist bedauernswert, diese Sicherheitsleute sind für deren Aufgabe nicht vorbereitet. Aber, meiner Meinung nach, gibt es in Brasilien keinen Rassismus. Jemand will dieses Thema zu uns importieren. Der Rassismus existiert nicht in Brasilien“.
Eine ganz andere Meinung vertritt die UNO: „Unsere Organisation stellt fest, dass weiterhin Millionen schwarzer Bürger Opfer des Rassismus, rassistische Diskriminierung und Intoleranz sind. Wir fordern eine gründliche Untersuchung des Falls, die Bestrafung der Täter und ermuntern das brasilianische Volk, eine Gesellschaft zu bilden, die frei von Rassismus ist“.
Rassissmus hat Geschichte
Die soziale Diskriminierung und der offene Rassismus haben eine lange Tradition in Brasilien, die etwa 350 Jahre zurück geht. Die Autorin Ines Eisele fasst in einem Interview für die Deutsche Welle, erschienen am 11.12.2019, das Thema zusammen:
„Gut die Hälfte aller Brasilianer hat afrikanische Wurzeln. Lange hielt sich der Mythos, dass es Rassismus wie etwa in den USA nicht gebe. Doch in Führungsetagen oder reichen Vierteln sucht man Schwarze meist vergeblich. Es gibt viele Bezeichnungen für dunkelhäutige Menschen genauso wie Farbschattierungen. Sie zeigen, wie sehr sich diese in dem Land vermischt haben. Vor allem aber wurden über 350 Jahre lang Millionen afrikanische Sklaven ins Land geschafft, so dass sich heutzutage ungefähr 51 Prozent der Brasilianer selbst als schwarz oder „pardo“, also braun beziehungsweise gemischt bezeichnen.
Auch viele der kulturellen Markenzeichen Brasiliens stammen ursprünglich von den afrikanischen Sklaven, wie der Samba, der Kampftanz Capoeira oder die Religion des Camdomble. All das lässt Brasilien schnell als harmonischen Schmelztiegel erscheinen, zumal es – nach dem Ende der Sklaverei – keine offizielle Rassentrennung wie in den USA oder Südafrika gab.“
Ungerechtigkeit hinterlässt Spuren in der Gesellschaft
Claudius Armbruster, frühere Präsident des Deutschen Lusitanistenverbands erklärt im selben Artikel der Deutschen Welle: „Nach dem Ende der Sklaverei im Jahr 1888 mussten sich die weißen Eliten die Frage stellen, wie sie mit den vielen neuen Bürgern afrikanischen Ursprungs umgehen. Die sogenannte „Rassendemokratie“ war ein ideologischer Entwurf, der es ermöglichte, auf der Oberfläche eine Integration anzudeuten, ohne diese ökonomisch und sozial tatsächlich vollziehen zu müssen.“
Der Artikel berichtet weiterhin: „In der Realität erhielten die vollkommen mittellos in die Freiheit entlassenen Sklaven keinerlei Unterstützung vom Staat. Diese Ungerechtigkeit hinterlässt bis heute Spuren in der Gesellschaft. So sind laut der nationalen Statistikbehörde drei Viertel der ärmsten zehn Prozent Afrobrasilianer. Dem Gini-Index zufolge, der Ungleichverteilung anzeigt, ist Brasilien eines der Länder, in denen die Schere zwischen Arm und Reich besonders groß ist. Und Arm und Reich ist in diesem Land eben oft gleichbedeutend mit Schwarz und Weiß.“
Der Artikel interviewt auch die Afrobrasilianerin Philosophin und Aktivistin Djamila Ribeiro. Sie hat persönliche Erfahrungen mit Rassismus im Alltag gemacht: „Wie viele Schwarze, die an Orten der Macht verkehren, etwa Universitäten, wurde ich schon verwechselt und etwa für eine Reinigungskraft gehalten. In einem Luxushotel dachte mal jemand, ich sei eine Prostituierte. Ich möchte die Würde dieser Beschäftigungen nicht anzweifeln, aber es sagt etwas, wenn man als schwarze Frau darauf reduziert wird“.
Die Stimmen sind wieder verstummt
Manche Wissenschaftler behaupten, Brasilien sei ein Land ohne Gedächtnis. Heute ist der 25.11.2020, nur sechs Tage nach dem Mord an dem Schwarzen Joao Alberto Freitas sind vergangen. Ich habe vergeblich in fast allen bekannten brasilianischen Zeitungen nach weiteren Nachrichten gesucht. Auch die landesweiten Proteste sind verstummt. Meine Erfahrung sagt mir, dass bald niemand mehr über den brutalen Fall reden wird. Ein ermordeter Schwarze mehr. Vergessen.