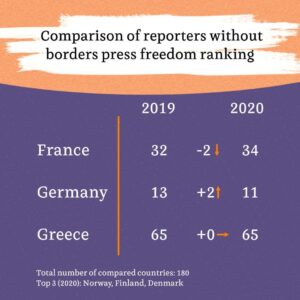Über 90 % der Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamt*innen wegen Gewaltausübung werden eingestellt. Die Studie Körperverletzungen im Amt durch Polizeibeamt*innen (KviAPol) gibt durch Befragungen von über 3300 Betroffenen und über 60 qualitative Interviews von Polizist*innen und anderen Menschen aus der Justiz tiefe Einblicke. Juristin und Kriminologin Laila Abdul-Rahman hat an der Studie mitgearbeitet und diese Befragungen teils durchgeführt und ausgewertet.
In welchem Rahmen darf die Polizei Gewalt anwenden und was wird im Kontrast dazu in der Studie unter Gewaltanwendung verstanden?
Die Polizei ist als Exekutivbehörde unter bestimmten Voraussetzungen befugt, Gewalt anzuwenden. Das wird Unmittelbarer Zwang genannt und dieser ist dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, und insbesondere, wenn das Verhältnismäßigkeitsgebot gewahrt ist, zulässig. Gewalt ist also auch für die Polizei immer nur das allerletzte Mittel.
Zunächst müssen Polizist*innen schauen, ob es andere Mittel gibt, die dazu führen könnten, dass die polizeiliche Maßnahme auch ohne Gewalt durchgeführt werden kann. In unserer Studie ging es letztendlich nicht darum, dass wir jetzt aus einer rein juristischen Perspektive in einzelnen Fällen prüfen, ob Situationen noch verhältnismäßig waren oder nicht. Es ging uns vielmehr darum zu sagen: Nicht immer, aber sehr häufig sind polizeiliche Gewaltanwendungen umstritten. Wir fragen uns einerseits, warum oder wie kam es dazu, dass die Betroffenen in unserer Befragung sagen „Wir haben polizeiliche Gewaltanwendung als übermäßig wahrgenommen“ und was auf der anderen Seite die polizeiliche Sichtweise darauf ist.
„Nicht immer, aber sehr häufig sind polizeiliche Gewaltanwendungen umstritten“
Letztendlich haben wir festgestellt, dass es verschiedene Sichtweisen auf das Thema geben kann. Es ist häufig sehr unterschiedlich, was eine Person als verhältnismäßig empfindet und das sind letztlich gesellschaftliche Fragen, denen wir uns versuchen in der Studie zu nähern, um aufzuzeigen, dass es immer auch einen gewissen Spielraum gibt, um sowas zu beurteilen.
Insgesamt fühlten sich 1/3 der Befragten während des Vorfalls diskriminiert und weitere 15 % bejahten dies zumindest zum Teil. Marginalisierte Gruppen unterliegen laut der Studie einem höheren Diskriminierungsrisiko. Wie kommt es dazu?
Dass marginalisierte Gruppen einem besonderen Risiko unterliegen, folgern wir einerseits aus der Befragung von Betroffenen, aber tatsächlich auch aus den Interviews mit Polizeibeamt* innen. Das Ergebnis ist also nicht nur Eigenwahrnehmung. Polizeibeamt*innen haben von problematischem Verhalten von Kolleg*innen oder von Strukturen berichtet, die ein besonderes Risiko darstellen. Das kann unter anderem am Erfahrungswissen von Polizist*innen liegen.
Damit ist gemeint, dass Polizeibeamt*innen in ihrer Arbeit nicht jedes Mal ganz neu entscheiden, sondern sie entscheiden in Situationen natürlich auf Grundlage der Erfahrungen, die sie in ihrem Beruf gesammelt haben. Das ist letztendlich, wie für jeden anderen Menschen auch, ein Einfallstor für rassistisches Wissen, welches in der Gesellschaft vorherrscht. Da geht es nicht nur um explizit rassistische Einstellungen, sondern um implizites Wissen, also um Stereotype, die man im Kopf hat, die einem vielleicht gar nicht die ganze Zeit präsent sind. Wenn man dann im Polizeiberuf zusätzlich noch negative Erfahrungen mit bestimmten Gruppen macht, dann können sich eben diese rassistischen Stereotype und Vorurteile verfestigen, sofern man diese nicht ausreichend reflektiert.
Zum Beispiel wurde in den Interviews geschildert, dass etwa bei Streifefahrten in einem Viertel mit einem hohen Migrationsanteil gleichzeitig die Kriminalitätsbelastung als hoch wahrgenommen wird. Dann kann es relativ schnell passieren, dass eine gedankliche Verbindung zwischen Migration und Kriminalität entsteht. Manche Polizist*innen berichteten, dass sie durchaus in bestimmte Gebiete mit einem hohen Migrationsanteil anders in den Einsatz reingehen als woanders.
„Das ist letztendlich, wie für jeden anderen Menschen auch, ein Einfallstor für rassistisches Wissen“
Es kann Einzelfälle geben, in denen man härter durchgreifen muss, aber es ist ein Problem, wenn man solche Annahmen pauschalisierend auf eine ganze Gruppe von Menschen überträgt. Aus polizeilicher Sicht werden dadurch bestimmte Personen nur aufgrund ihrer zugeschriebenen Herkunft etwa als respektloser oder gefährlicher wahrgenommen, sodass dann auch die Hemmschwelle geringer sein kann, gegenüber diesen Personen eine Maßnahme mit Gewalt durchzusetzen.
Als psychische Folgen der Vorfälle wurde von Betroffenen ein Ohnmachtsgefühl und ein Vertrauensverlust in den Staat beschrieben. Obwohl People of Color keine schwereren körperlichen Verletzungen als weiße Personen erfahren haben, waren sie jedoch stärker psychisch belastet. Warum ist das so und welche Folgen zieht ein solcher Vertrauensverlust nach sich?
Eine Erklärung ist, dass eben zusätzlich zu der Gewalterfahrung noch hinzukommt, dass man sich diskriminiert gefühlt hat. Es kommt zu einer Art Doppelviktimisierung, also einerseits die psychische Belastung durch die körperliche Gewalterfahrung, aber gleichzeitig auch durch das Gefühl, aufgrund seiner Herkunft oder wie man eben wahrgenommen wird, diese Gewalt erfahren zu haben.
Zusätzlich haben uns People of Color häufiger berichtet, dass sie solche Situationen schon öfter erlebt haben. Das waren nicht in allen Fällen immer Gewaltsituationen, aber Diskriminierungssituationen, die für die meisten nicht das erste Mal vorkamen. Das führt auf lange Sicht dazu, dass man sich psychisch stärker belastet fühlt und das Vertrauen in den Staat verliert. Der Vertrauensverlust ist bei diesen Personen dann sehr nachhaltig.
Diskriminierung ist immer ein Thema und gerade wenn Diskriminierung durch den Staat erfolgt, ist es natürlich ein Problem, über das man sprechen muss. Einerseits ist es gut für eine Gesellschaft, sich mit diesen Diskriminierungserfahrungen auseinanderzusetzen und das auch als Chance zu sehen, dass Menschen das jetzt mehr thematisieren. Gleichzeitig handelt es sich um einen Zustand, in dem wir uns fragen müssen, wie es sein kann, dass das so viele Menschen betrifft und wir müssen schauen wie eine staatliche Behörde wie die Polizei damit umgeht.
„Wenn Diskriminierung durch den Staat erfolgt, ist es natürlich ein Problem, über das man sprechen muss“
Im Hinblick auf die gesamte Betroffenengruppe kamen die Befragten überwiegend im Rahmen von Demonstrationen und Großveranstaltungen in Kontakt mit der Polizei, während Menschen mit Migrationshintergrund vor allem in Personenkontrollen oder Konflikten, zu denen die Polizei dazu gerufen wurde, mit Polizeibeamt*innen zusammentrafen. Gehen diese Erkenntnisse einher mit Vorwürfen ggü. der Polizei bezüglich Racial Profiling?
Da wir uns nur Situationen angeschaut haben, in denen es auch zu Gewalt kam, sind wir keine Racial Profiling-Studie. Dafür müsste man sich Kontrollsituationen insgesamt anschauen. Man kann also nicht direkt den Schluss ziehen, dass wir quasi bestätigt haben, dass People of Color häufiger in Deutschland kontrolliert werden. Nichtsdestotrotz bestätigen unsere Daten schon die Tendenz, die wir auch in vielen anderen Betroffenenberichten oder Studien sehen.
Man sieht, dass es sich je nach Einsatzsituation unterscheidet, wer eigentlich von polizeilicher Gewalt betroffen ist. Dabei sollte man sich vor Augen führen, dass es natürlich auch ein großes Problem ist, wenn ich zu einer Demonstration gehe und dort Gewalt erlebe. Ich kann aber entscheiden, zu einer Demonstration zu gehen oder nicht. Menschen, die hingegen aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer zugeschriebenen Herkunft häufiger kontrolliert werden, die können letztendlich nichts daran ändern. Sie könnten nur noch zu Hause bleiben.
Tatsächlich wird als Folge der Vorfälle auch von Vermeidungsverhalten in der Studie berichtet, also dass Personen versuchen, nicht mehr an bestimmte Orte zu gehen. Aber das ist natürlich sehr schwierig, wenn man am Leben teilnehmen will und zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel nutzen muss.
„Es unterscheidet sich je nach Einsatzsituation, wer eigentlich von polizeilicher Gewalt betroffen ist“
Insgesamt haben 19 % der Betroffenen sogar von schweren physischen Verletzungen berichtet. Dennoch gaben nur 9 % an, dass für sie eine Anzeige in Betracht kommt. Welche Befürchtungen haben die Betroffenen?
Die Befragten haben überwiegend angegeben, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass eine Anzeige am Ende mit Erfolg gekrönt wäre. In den Ermittlungsverfahren ist die Einstellungsquote sehr hoch. Wir haben nur eine Anklagequote von 2 % und dieses Wissen haben viele Betroffene spätestens dann, wenn sie sich anwaltlich beraten lassen, was tatsächlich auch ein gewisser Anteil tut.
Wir haben auch Interviews mit Anwalt*innen geführt, die uns erzählt haben, dass sie aufgrund der hohen Einstellungsquote in vielen Fällen davon abraten, eine Anzeige gegen Polizeibeamt*innen zu stellen, außer man hat wirklich sehr gute Beweise, wie etwa ein Video, auf dem man deutlich die Gewaltanwendung sieht. Wenn es keine weiteren Zeug*innen und auch kein Video gibt, dann ist einfach die Beweislage sehr schwierig. Es steht Aussage gegen Aussage.
„In den Ermittlungsverfahren ist die Einstellungsquote sehr hoch“
Zusätzlich kann durchaus die Glaubwürdigkeit der Betroffenen im Vergleich zu der der Polizeibeamt*innen bei der Staatsanwaltschaft, aber auch vor Gericht als geringer eingeschätzt werden. Einige haben auch Angst davor, dass sie am Ende selbst mit Konsequenzen rechnen müssen. Es gibt dann häufig auch Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und da muss man eben sagen, dass dort die Einstellungsquoten viel geringer und die Verurteilungsquoten sehr hoch sind.
Ein strukturelles Problem dieser Strafverfahren, das die hohe Einstellungsquote in Fällen von übermäßiger Gewaltanwendung durch Polizist*innen begünstigten kann, ist laut eurer Studie das sog. Geradeschreiben von polizeilichen Berichten?
Häufig ist es so, dass zunächst durch die Staatsanwaltschaft die polizeilichen Berichte angefordert werden. Die Polizei muss immer einen Bericht über ihre Einsätze schreiben und dabei kann es auch zum sogenannten Geradeschreiben kommen. Das ist tatsächlich ein Begriff, den wir uns nicht ausgedacht haben, sondern der uns mehrfach in den Polizeiinterviews genannt wurde.
Man schreibt keine Lüge auf, aber es fängt zum Beispiel damit an, dass man möglicherweise nicht jedes Detail in den Bericht reinnimmt. Aus der Perspektive des Beamten, der die Gewalt angewendet hat, wird das Geschehen dann natürlich so dargestellt, dass das am Ende auch rechtssicher und verhältnismäßig ist. Da werden keine Zweifel reingeschrieben, die er oder sie bei der Gewaltanwendung möglicherweise hatte. Vorgesetzte erwarten auch von ihren Mitarbeitenden, dass solche Berichte am Ende nicht von der Staatsanwaltschaft beanstandet werden können.
„Da werden keine Zweifel reingeschrieben, die er oder sie bei der Gewaltanwendung möglicherweise hatte“
Das ist sicherlich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar und normal, hat aber die Gefahr, dass das letztlich ein Bericht ist, der aus einer ganz bestimmten Perspektive, nämlich aus der polizeilichen Perspektive, geschildert wird. Damit liegt die Definitionshoheit, also die Möglichkeit zu definieren, wie diese Situation damals war, bei der Polizei und das kann sich dann in den Ermittlungen häufig durchsetzen. Diese Struktur kann man nur brechen, indem man nicht davon ausgeht, dass ein Polizeibericht ein rein objektives Beweismittel ist, welches die Wahrheit quasi widerspiegelt, sondern dass dieser auch eine subjektiv geprägte Perspektive darstellt, die man entweder durch eine mündliche Vernehmung noch mal hinterfragen oder durch andere Beweismittel kontrollieren müsste.
In der Studie wird andererseits aufgezeigt, dass es auch für Polizeibeamt*innen hohe Hürden gibt, die Legitimität einer Maßnahme von Kolleg*innen anzuzeigen. Sind damit rechtliche oder vor allem strukturelle Hürden innerhalb der Gemeinschaft von Polizeibeamt*innen gemeint?
Zum einen ist es natürlich eine kollegiale Hürde. Im Polizeiberuf ist man ganz stark darauf angewiesen, dass man unter den Kolleg*innen zusammenhält, da man zusammen auch gefährliche Situationen durchlebt. Da ist es sicherlich auch menschlich nachvollziehbar, dass es schwierig ist zu sagen „Du hast was falsch gemacht, ich sage jetzt gegen dich aus“. In unseren Interviews wurde uns berichtet, dass das nur in Fällen gemacht wird, die wirklich sehr schwerwiegend waren.
Es gibt oft einen Graubereich, in dem viele sagen, dass sie es anders gemacht hätten oder dass es vielleicht nicht das gänzlich mildeste Mittel war, was man hätte finden können. Von einer Aussage gegen Kolleg*innen wird dann trotzdem abgesehen. Oft wisse man nicht, ob das jetzt wirklich schon rechtswidrig war. Dann kommt es auch so ein bisschen auf die Kultur an, die man dort, wo man eingesetzt ist, vorfindet. Also ob sowas vielleicht vom Vorgesetzten irgendwie gefördert wird oder ob man da eher das Gefühl hat, man darf eigentlich keine Fehler thematisieren oder machen.
„Zum einen ist es natürlich eine kollegiale Hürde“
Andererseits kann es auch sein, dass Beamt*innen dann selber überlegen müssen, wenn sie in der Situation dabei waren, ob sie sich vielleicht selbst strafbar gemacht haben, weil sie natürlich grundsätzlich auch dazu verpflichtet gewesen wären einzugreifen, wenn es zu einer übermäßigen Handlung kommt.
Gibt es einen Reformbedarf in der Ausbildung von Polizist*innen im Hinblick auf eine Sensibilisierung in Bezug auf Gewaltanwendungen sowie den Umgang damit?
In der Ausbildung von Polizist*innen hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Man muss sich vor Augen führen, dass obwohl die Ausbildung natürlich sehr wichtig ist, sie letztendlich auch nur ein kurzer Teil am Anfang des Berufslebens darstellt. Die Befragten berichten, dass sie viele Dinge erst wirklich in der Praxis lernen.
Ich halte es natürlich für extrem wichtig, dass sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die gesellschaftlichen Perspektiven in der Ausbildung auf Gewaltanwendungen thematisiert werden, sodass es schon von Beginn an eine Sensibilisierung dafür gibt, dass diese Befugnis, die man hat, wirklich nur als Ausnahme zu verstehen ist. Vielmehr müsste man aber auch kritisch darüber nachdenken, welche Zwangsmittel überhaupt eingesetzt und welche Gewalttechniken im Rahmen des Einsatztraining gelehrt werden sollten.