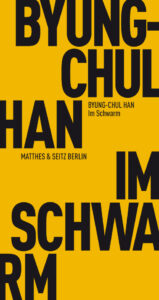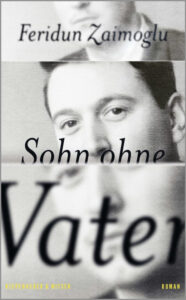Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe nelken & nostalgie! Heute teilt Victoria ein Rezept aus Frankreich mit dir: Die Tarte au Citron – eine spritzig-frische Zitronentarte, gekrönt mit einem luftig-leichten Hauch Baiser.
Victorias Wurzeln liegen irgendwo zwischen Straßburg, Brüssel und Zürich. Vor allem aber sind sie eins: französisch. Ihre beiden Eltern sind im französischsprachigen Raum aufgewachsen, und ein großer Teil ihrer Familie lebt bis heute in Frankreich.
Victoria sagt über sich: “Mein Herz schlägt für Archäologie, Kunst und Geschichte – und seit kurzem auch für den Journalismus. Ich schreibe als freie Autorin für DIE ZEIT und bin bei kohero, weil ich überzeugt bin: Heute brauchen wir mehr denn je interkulturellen Zusammenhalt und die Offenheit, voneinander”.
Ihr Zitronentarte-Rezept macht auf jeden Fall Lust auf Sommer, Wind und Wellen.
PS: Inzwischen haben schon mehrere Menschen aus unserem kohero Team und der Community ihre Geschichten und Lieblingsrezepte geteilt. Wenn auch du deinen Beitrag für diesen Newsletter schreiben möchtest, schick mir deine Idee gerne hier.
Tarte au Citron: eine Postkarte aus der Vergangenheit
Früher verbrachten wir als Familie jeden Sommer in der Bretagne. Mit der Zeit wurde die raue Atlantikküste zu einem zweiten Zuhause für mich – vermutlich einer der Gründe warum ich den Norden so mag. Nach einem langen Tag am Meer, irgendwo zwischen salziger Luft, Wind im Haar, von Steinen gesäumten Buchten und der Jagd nach kleinen Krebsen im kniehohen Wasser, entdeckte ich sie zum ersten Mal: die Tarte au Citron.
In einer kleinen Pâtisserie auf dem Heimweg lachte sie mich durch die Auslage an – sonnengelb, glänzend, eingefasst in mürben Teig, bedeckt mit fluffigem Baiser – beim Anbeißen ein leuchtend gelbes Versprechen von Sommer. Ich erinnere mich noch genau an diesen ersten Bissen: cremig, säuerlich, leicht wie Luft. Erstaunlich erfrischend – ein kleiner Pick-me-up nach Sonne, Wind und Wellen. Und plötzlich war sie mehr als ein Kuchen. Sie wurde zum Ritual.
Seither ist sie mein kulinarischer Sommerbote – jedes Jahr ab Mai backe ich sie, als Auftakt in den Sommer. Und dann noch mindestens zwei weitere Male, bis die Blätter wieder fallen. Die Tarte au Citron ist mein ganz persönliches Stück Frankreich.
Eine Tarte, viele Heimaten
Ursprünglich stammt die Tarte au Citron wohl aus dem südfranzösischen Menton, wo sie bis heute im Frühling mit der farbenfrohen Fête du Citron gefeiert wird. Doch längst ist sie über Grenzen gewandert – als Lemon Pie in den USA, wo sie als kalifornische Spezialität gekannt und geliebt wird oder als Lemon Curd in England – abgepackt im Marmeladenglas. Und wie jedes Land ihre eigene Version geschaffen hat, habe ich das auch.
In der Bretagne schmeckte sie nach Wind, Salz und Sonne – natürlich mit gesalzener Butter gebacken, ganz à la Breizh. In Paris empfahl man mir in einer Patisserie, Mandeln in den Mürbeteig einzuarbeiten – für mehr Struktur und Tiefe. Und in Toulouse pflückten wir Zitronen und Lavendel im Garten meiner Tante, der die Tarte dann schmückte.
Auf all meinen Stationen – Zürich, Konstanz, Paris, Heidelberg, Hamburg – habe ich Freund*innen aus aller Welt gewonnen. Viele davon begleiten mich bis heute. Eine von ihnen ist meine englische Freundin Rachael, die ihren Lemon Pie ohne Baiser, dafür mit Blaubeeren und einer Prise mehr Salz im Teig serviert – eine überraschend feine Balance. Bei ihr habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie fein abgestimmt ein Teig schmecken kann, wenn man mutig mit dem Salz ist.
Jede dieser Zutaten hat sich still in mein Rezept eingeschrieben – wie kleine Postkarten aus der Vergangenheit.
Was mir besonders Spaß macht: das Garnieren! Ein Basilikumblatt, Zitronenscheiben, Lavendel, Puderzucker oder einfach ein Tupfer Baiser. Die Tarte au Citron ist eine Leinwand – jede Version ist ein neues Bild, eine Erinnerung, ein Ort. Und genau so soll sie schmecken.
Erinnerung, Ritual, Brücke
So wurde die Tarte au Citron für mich zu mehr als einem Dessert. Sie ist ein Ritual. Eine Erinnerung. Eine Brücke zwischen Menschen, Ländern und Zeiten. Heute, in meiner kleinen Wohnung in Hamburg, backe ich die Tarte au Citron mit salziger Butter aus der Bretagne, Mandeln aus Paris, einem Hauch Lavendel aus Toulouse – und einem Lächeln für Rachael. Mit jedem Bissen spüre ich: Ich bin hier – und zugleich in Frankreich, in meiner Erinnerung, in meiner Geschichte.
Ich hoffe, du startest mit meiner Tarte au Citron spritzig und luftig-leicht in den Sommer! Wo auch immer du bist, wo auch immer es dich hinzieht – Bon appétit und un petit morceau de patrie!
Deine Victoria
Das Rezept: La Tarte au Citron
Zutaten für eine Tarte (ø28 cm):
Für den Mürbeteig
250 g Mehl
125 g kalte Butter
1 Ei
1 Eigelb
1 Prise Salz
1 Pck. Vanillezucker
3 EL Zucker
etwas Butter für die Form
etwas Mehl für die Form
Optional: 1 EL Mandelpulver
Für die Zitronen-Füllung
2 Eier
2 Eigelbe
1 EL Speisestärke (alternativ 3 Esslöffel Mehl)
100 g Puderzucker
150 ml frisch gepresster Zitronensaft
1 TL frisch geriebene Zitronenschale
Für das Baiser
3 Eiweiß
1 Prise Salz
100 g Puderzucker
Zubereitung:
- Vorbereitung:
Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (Umluft: 180 °C) vorheizen. Eine Tarteform (Ø 28 cm) mit Butter einfetten und mit ein bisschen Mehl bestreuen. - Mürbeteig:
Mehl, kalte Butter in Stücken, Ei, Eigelb, Salz, Vanillezucker und Zucker mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Auf einer bemehlten Fläche ausrollen, in die Form legen und einen ca. 3 cm hohen Rand formen. Der Rand kann verschieden gestaltet werden: wellig, glatt oder zackig. Den Teigboden mit einer Gabel einstechen und ca. 15–20 Minuten vorbacken. Anschließend etwas abkühlen lassen. - Zitronenfüllung:
Die Eier und Eigelbe schaumig rühren. In einem Topf Puderzucker, Speisestärke (oder Mehl), Zitronensaft und Zitronenschale vermengen und bei mittlerer Hitze leicht erwärmen. Die Eiermischung unterrühren und alles so lange erhitzen (nicht kochen!), bis die Masse andickt. Noch warm auf den vorgebackenen Boden geben und glattstreichen. Die Ofentemperatur auf 160 °C (Umluft: 140 °C) reduzieren. - Baiser:
Eiweiße mit einer Prise Salz steif schlagen. Nach und nach den Puderzucker einrieseln lassen und weiterschlagen, bis die Masse steif ist. Der ultimative Test: die Schale umgedreht über den Kopf halten: wenn du von einer Schaumkrone verschont bleibst, weißt du, der Baiser ist ready (ansonsten musst du wohl nochmal von Neuem anfangen). Das Baiser auf der Zitronencreme verteilen und mit einem Löffel dekorative Wellen oder Spitzen ziehen. - Backen:
Die Tarte etwa 20 Minuten backen, bis das Baiser golden schimmert.
Und fertig ist die Tarte – bon appétit!
Das Geheimnis

Mit frischen Bio-Zitronen entfaltet die Tarte ihr volles Aroma! Sie bringen den Geschmack und die Frische eines echten französischen Sommers in die eigene Küche. Und was besonders Spaß macht: das Garnieren! Ein Basilikumblatt, Zitronenscheiben, Lavendel, Puderzucker oder einfach ein Tupfer Baiser. Die Tarte au Citron ist eine Leinwand – jede Version ist ein neues Bild, eine Erinnerung, ein Ort. Und genau so soll sie schmecken.