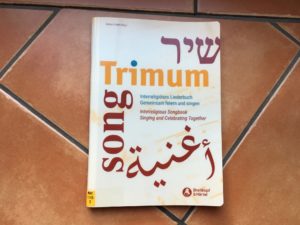Mit roten Haaren, die man selten in Syrien finden kann und mit einer faszinierenden Stimme singt Lena Chamamyan auf der Bühne. Für sie ist Musik ein Instrument, um den Schmerz der Flucht und die Gefühle auszudrücken.
Lieder über Flucht und Liebe
„Das Leben im Exil ist ein Spiegel. Du stehst ehrlich davor. Das bist du und du kannst nicht entkommen oder lügen. Du hast gar nichts und musst trotzdem überleben“, sagt die Sängerin in einem Interview mit dem Flüchtling-Magazin. Sie lebt seit 2012 in Paris. Wie viele Syrer befand sie sich in einem grausamen Krieg und musste fliehen und alles zurücklassen.
In ihrem ersten Album im Exil Ghazel El Banat, auf Deutsch “ Zuckerwatte“, spricht Lena aus ihrer persönlichen Erfahrung den Krieg in Syrien und die Flucht nach Europa an. Sie richtet sich mehrmals auch an Frauen. Lena ist nicht nur eine Sängerin, die eine atemberaubende Stimme hat, sondern sie schreibt die Liedtexte und komponiert manchmal ihre Musik selbst und stellt sich als eine Musikerin vor. „Europa bringt mir die Unabhängigkeit bei“, meinte sie.
Sie wehrt sich dagegen, Syrer, die vor dem Krieg geflüchtet sind, auf den Begriff ‚Flüchtling‘ zu reduzieren. „Ich finde das Wort Flüchtling verletzend. Ein Flüchtling sollte Survivor genannt werden, denn er ist ein Überlebenskämpfer“, sagte sie in einem Interview mit SWR.
Integration mit syrischer Identität
Nach dem Konzert trifft Chamamyan sich immer mit vielen Syrern. Dann tauschen sie ihre Geschichten aus. „In Dresden habe ich einige Syrer getroffen, die derzeit Medizin studieren. Ich bin sehr stolz darauf, wenn ich die Syrer sehe, die Deutsch sehr schnell gelernt haben und nun deutsche Unis besuchen konnten. Sie haben sich integriert und trotzdem ihre syrische Identität aufrechterhalten“, sagte Chamamyan.
„Was mich auch freut, das sind syrische Journalisten, die jetzt in den deutschen Zeitungen und Magazinen schreiben. Es ist nicht nur Integration, sondern Umprogrammierung des Gehirns fürs Engagment in der Gesellschaft“, sagt sie dazu.
Bei ihrem letzten Besuch in Berlin organisierte Lena ein Konzert und war erstaunt, dass so viele Syrer sich hier integrieren konnten und viele syrische Geschäfte in Deutschland eröffnet haben.
Wenn sie Syrien vermisst, dann kommt sie nach Deutschland. Dort kann sie die syrischen Gewürze noch einmal riechen und syrische Süßigkeiten essen.
Musik ist eine Brücke zwischen den Kulturen
Chamamyan trat in den vergangenen Jahren in Deutschland, Kanada, verschiedenen arabischen und europäischen Länder auf und sang mehrmals auf den deutschen Bühnen. Ihr Ziel ist es, die syrische Kultur weltweit zu verbreiten und zu betonen, dass der Krieg in Syrien nur eine kurze Phase in der Geschichte Syriens sei. „Wir kommen aus einem alten Ort und haben ein großartiges kulturelles Erbe, das wir in jeder Gesellschaft hinzufügen können“, sagte sie in einem Telefongespräch.
In Konzerten spricht und singt sie auf Arabisch, Armenisch, Englisch und Französisch, denn die Zuhörer sind nicht nur Araber, sondern aus unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. „Ich komme aus Damaskus und habe einen armenischen Ursprung. Dort lernte ich nur Damaszener kennen. Was ich in Deutschland liebe, ist, dass man hier viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sehen kann“.
Konzerte in Deutschland
Deutschland ist für sie eine wichtige Haltestelle im Jahr. Lena verspricht ihren Fans, dass es jährlich vielen Konzerte in Deutschland geben wird. „Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich keine Konzerte in Deutschland habe. Die Konzertbesucher befreien mich von all dem, was ich jeden Tag erlebe“.