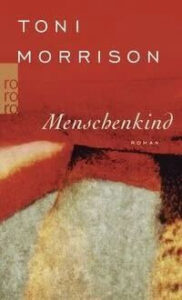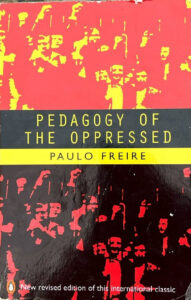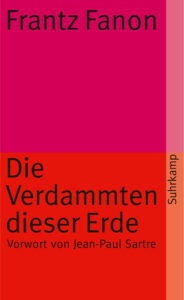Heute widmen wir uns einem Thema, das schon lange auf meiner Agenda steht – einerseits wegen meiner eigenen Erfahrungen, andererseits aufgrund seiner großen gesellschaftlichen Bedeutung. Es geht um Religionen, insbesondere den Islam, und mentale Gesundheit. Dieses Thema betrachte ich mit viel Respekt und Achtsamkeit, da Muslim*innen oft Anfeindungen und Vorurteilen ausgesetzt sind und in wissenschaftlichen Diskussionen ausgeklammert werden. Daher ist mein Anspruch, besonders sorgfältig und respektvoll damit umzugehen und vertiefende theologische Fragen jenen zu überlassen, die über das nötige Fachwissen verfügen. Dazu später mehr.
Auch in der westlichen Psychotherapie wird in der Regel versucht, Religion als Ressource anzunehmen und zu nutzen. Die Korrelation zwischen Religiosität und mentaler Gesundheit ist ein Thema, das in der Wissenschaft kontrovers diskutiert wird. Studien zeigen, dass Religiosität unter gewissen Bedingungen positiv mit mentaler Gesundheit korrelieren kann.
Beispiele hierfür sind:
Soziale Unterstützung: Religiöse Gemeinschaften bieten soziale Netzwerke, die Isolation reduzieren und Unterstützung in schwierigen Zeiten bieten können.
Sinn und Zweck: Viele religiöse Menschen schöpfen Kraft aus dem Gefühl von Sinnhaftigkeit und einer höheren Ordnung, was ihre Resilienz stärkt.
Stressbewältigung: Religiöse Rituale und Gebete können als Bewältigungsmechanismen wirken, die Ängste lindern und Hoffnung fördern.
Moralische und ethische Orientierung: Religiöse Werte bieten oft eine klare Lebensstruktur, die Entscheidungen erleichtert und Unsicherheiten reduziert.
Gegenwärtig stehen Muslim*innen auf der ganzen Welt vor großen Herausforderungen und Krisen, die eine Vielzahl von psychischen Problemen hervorrufen. Von traumatischen Erlebnissen in von Krieg geprägten Ländern wie Syrien und Palästina bis hin zur Bewältigung der Islamophobie im Westen besteht ein zunehmender Bedarf an psychischen Gesundheitsdiensten für muslimische Communities. Der Großteil sucht jedoch keine psychotherapeutischen Dienste auf, da die Psychotherapie sich nicht auf informierte und offene Weise mit religiösen Werten auseinandersetzt.
Es sind Ansätze erforderlich, die muslimische Werte und Realitäten widerspiegeln. Im Laufe der Geschichte des islamischen Denkens und Wissens gab es viele muslimische Gelehrte, die über Konzepte der menschlichen Psyche geschrieben und unterrichtet haben; auch der Quran thematisiert die menschliche Seele in ihren verschiedenen Aspekten. Der Begriff „nafs“ (kurz „Seele“), der auf mehreren Ebenen verschiedene Bedeutungen in sich trägt, kommt ganze 295 Mal vor.
Tatsächlich gibt es viel wissenschaftliche Arbeit über die Psychologie der Menschheit, wie sie aus koranischen und prophetischen Quellen abgeleitet ist, dass es verzerrt wäre, die islamische Psychologie als neue Disziplin zu bezeichnen. Aber: Ein theologisches Verständnis, das nicht exklusiv, sondern zugänglich sein soll, ist nötig, um die Religion als die Ressource zu nutzen, die sie sein kann.
Daher möchte ich für die nächste Ausgabe Fachexpertise heranziehen. Vor allem hierfür sind deine Beiträge wichtig und erwünscht! Was möchtest du über den Zusammenhang von Psychologie und Islam wissen? Ich freue mich darauf, deine Fragen und Anregungen aufzufangen und in das Interview einfließen zu lassen!