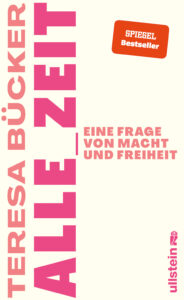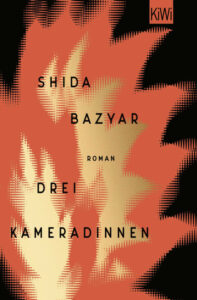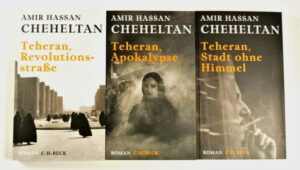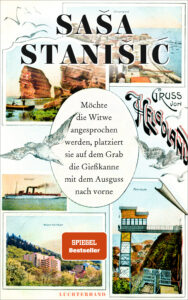Was man besonders an Olga Grjasnowa schätzt – und was ihr auch in diesem neuen Roman „Juli, August, September“ wieder gelingt – ist ihr bitterer Humor, der keine Grenzen kennt. Sie schafft es, tragische Geschichten mit einem Humor zu erzählen, der den Leser*innen zwischen Lachen und Nachdenklichkeit hin- und herreißt. Man ertappt sich dabei, über hochkomplexe und tief ernste Themen zu lachen, denn Olga Grjasnowa setzt sie sich auch diesmal intensiv mit der Frage der Identität auseinander.
Bereits seit der Veröffentlichung deines Debütromans giltst du eine der wichtigsten Stimmen der jungen deutschen Literatur. Behzad Karim Khani sagte zuvor, dem deutschen Literaturbetrieb fehle Schub von der Straße. Daran anknüpfend sagte Shida Bazyar, die unkonventionellen und mutigen Texte gelten eher als Ausnahmen, sozusagen als „Gäste“ in der deutschen Literaturlandschaft. Was sagst du? Spiegelt die gegenwärtige deutsche Literaturlandschaft aus deiner Sicht die Vielfalt der Gesellschaft?
Ich bin mir nicht sicher, ob es die Literatur – egal in welcher Gesellschaft – es je tut. Ich würde auch gerne festhalten, dass Literatur nicht die Realität ist, sondern die konstruierte und manchmal vereinfachte Abbildung oder auch Vermeidung oder eine Annahme dieser ist. Es gab mehr als genug Versuche, dies in der Literatur zu erreichen, wie etwa in der Sowjetunion, aber es ist nicht sehr gut ausgegangen. Zumindest künstlerisch. Ich glaube auch nicht an die Glorifizierung der Straße, dafür kenne ich zu viele Menschen, die da gelandet sind. Aber, auch, weil ich literarisches Schreiben unterrichte, es wird immer vom Jahrgang zum Jahrgang diverser!
Ehrlich gesagt, ist es auch nicht die „Schuld“ der Schreibenden, sondern auch die der „Lesenden“ – welche Texte werden am liebsten gelesen, gekauft, rezipiert? Es sind nicht die mutigsten und unkonventionellen. Nur auch da müssen wir zwischen Genre und Biografie unterscheiden, die bedingen sich nicht.
In deinem neuen Roman „Juli, August, September“ erzählst du eine schmerzhafte Familiengeschichte auf eine witzige Weise. Die Geschichte ist extrem bitter, jedoch sehr unterhaltsam. Inwiefern hängt die Art von Erzählen mit deiner eigenen Familiengeschichte und Biografie zusammen?
In diesem Buch ist es ein Spiel damit, eine Art was wäre wenn. Aber das ist vielleicht auch mein eigener Zugang zum Schreiben, ausgehend von mir alles zu potenzieren. Aber die Geschichte aus „Juli, August, September“ basiert auf den Erzählungen meiner Großmutter, nur Maya ist erfunden.
Entfremdung und Identität sind Fragen, die du in all deinen Werken thematisiert hast. Woher liegt diese Auseinandersetzung mit der Identitätsfrage?
Eigentlich fand ich immer, ich setzte mich nicht damit auseinander. Nur in den letzten beiden Romanen. Und das sind tatsächlich Fragen, die sich aus meiner Biografie heraus stellten.
Du hast auch ein Sachbuch zur Mehrsprachigkeit veröffentlicht und bist auch selbst mehrsprachig aufgewachsen. Wie prägt die Mehrsprachigkeit dein Schreiben?
Ich bin eigentlich nur mit Russisch aufgewachsen und habe mit elf Jahren Deutsch gelernt, aber ich war immer in mehrsprachigen Umgebungen. Mein Traum war immer, mehrere Sprachen fließend sprechen zu können, aber ich habe es nur bei Deutsch und Englisch geschafft, was ziemlich traurig ist.
Eigentlich ist mein Schreiben ausschließlich monolingual deutsch. Bei der Recherche konsumiere ich allerdings alles, auch vieles, was auf Englisch oder Russisch geschrieben wurde.
Könntest du uns zwei oder drei literarische oder non-fiction Werke nennen, die dein Schreiben und deinen Werdegang als Autorin geprägt haben?
Oh ja! Ich verehre Sigrid Nunez und Percival Everett. „Half of a Yellow Sun“ von Chimamanda Ngozi Adichie hat mich viel über Form gelehrt, und Zadie Smith mich als 19-Jährige darüber, dass Literatur Spaß machen und divers sein kann.