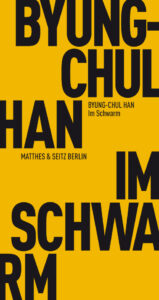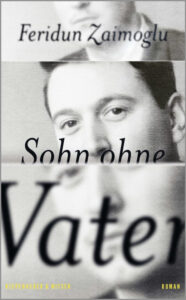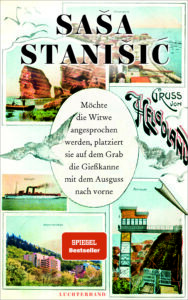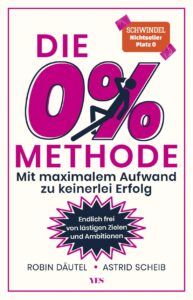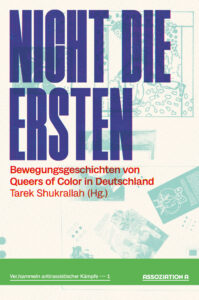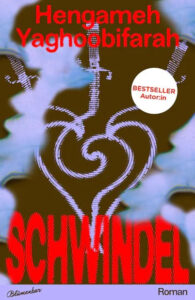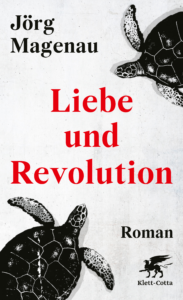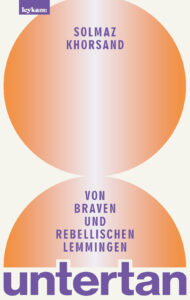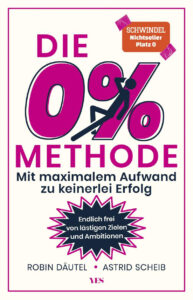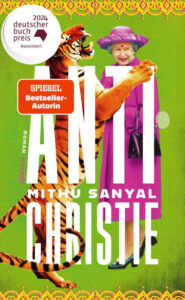Kaum ein Gefühl ist so hartnäckig wie die Scham. Sie sitzt tief, oft ohne Namen, aber mit Wirkung: in der Stimme, im Gang, in der Art, wie wir schweigen, wenn wir eigentlich etwas sagen sollten. Scham ist der unsichtbare Begleiter vieler Biografien – und für Menschen mit Migrationsgeschichte ist sie fast schon ein Pflichtgefühl.
Denn wer in dieser Gesellschaft zur Minderheit gehört, weiß, wie effizient die Mehrheitsgesellschaft darin ist, den Blick zu senken. Es reicht ein schiefer Ton, eine beiläufige Bemerkung, ein Blick zu viel oder zu wenig – und schon beginnt die innere Arbeit: War ich zu laut? Zu falsch? Zu sichtbar?
Diese Mechanismen des Einübens, des Zurechtweisens, des moralischen Disziplinieren – freundlich verpackt als „Integration“ – sind subtil, aber wirkungsvoll. Matthias Kreienbrink hat ihnen ein Buch gewidmet: Scham. Und dieses Buch ist kein psychologischer Ratgeber, sondern ein durchdrungener Versuch, diesem Gefühl auf den Grund zu gehen. Ganz ohne es zu beschönigen, aber auch ohne sich davon lähmen zu lassen.
Matthias, in deinem Buch „Scham“ verwebst du persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Analysen. Wann wusstest du, dass das Thema Scham nicht nur dein eigenes Leben durchzieht, sondern auch eines ist, über das du schreiben willst?
Mir ist vor ein paar Jahren aufgefallen, dass ich als Journalist immer wieder über Themen schreibe, in denen es auch um die Scham geht – ohne dass ich das geplant hätte. Selbst in meiner Unizeit habe ich schon in mittelalterlichen Texten nach der Scham gesucht. Und so schlug ich damals, Mitte 2022, dem Dossier der ZEIT vor, einen langen Text über die Scham zu schreiben. Nach der Veröffentlichung fragte eine Literaturagentin, ob ich daraus nicht auch ein Buch machen möchte – und so kam es dann dazu.
Du beschreibst sehr offen deine Kindheit und Jugend, sprichst über Körperbilder, Ausgrenzung und soziale Herkunft. Wie hast du als Autor entschieden, welche persönlichen Geschichten du teilen willst – und welche nicht?
Über die Jahre habe ich immer wieder auch Artikel aus meiner Perspektive geschrieben. Über das Abnehmen, über Angststörungen, über Tattoos. Mir ist dabei aber immer wichtig, keine Nabelschau zu betreiben, sondern diesen Ausgangspunkt – meine Erfahrungen – zu nutzen, um dann mit anderen Menschen, Betroffenen wie Expert*innen, zu sprechen.
Schreiben ist für mich oft hilfreich. Ich kann teils diffuse Gedanken in Sätze bannen und gebe ihnen somit eine neue Struktur. Insofern gibt es erstmal nichts, das mir per se „zu persönlich“ wäre. Denn beim Schreiben kann ich jedes Thema auf eine Meta-Ebene bringen und es somit „objektivierbar“ machen. Es ist für mich also immer eher die Frage, WIE ich über ein Thema schreibe. Und da ist es wichtig beim Schreiben genau wahrzunehmen, mit welchen Formulierungen, mit welchen Narrationen ich mich wohlfühle und mit welchen nicht. Wo ich gerne im Text heranzoomen möchte und wo nur darüber fliegen.
„Scham“ ist ein stark politisches Buch – auch wenn es oft leise daherkommt. Wie hat dein Blick auf Macht und Marginalisierung deine Auseinandersetzung mit Scham geprägt? Und spielt dein eigener biografischer Hintergrund dabei eine Rolle?
Die Macht der Scham habe ich früh gespürt – spüren müssen. Als Teenager war ich Ziel von Mobbing. Wegen meines Übergewichts, weil ich mich „zu weiblich“ benommen habe. Dass ich schwul bin, war damals für mich selbst noch gar nicht so präsent, dafür hat auch die Scham gesorgt.. Ein Verständnis dafür hatte ich also früh. Dass Scham und Beschämung aber sehr stark gesellschaftlich genormt sind, einige Personengruppen oft mehr treffen als andere – das musste ich und das müssen wir alle im Laufe des Lebens lernen. Insofern haben vor allem die theoretische Auseinandersetzung mit dieser Emotion und meine Gespräche mit vielen unterschiedlichen Menschen meinen Blick für das Politische der Scham geschärft.
Im Buch kommen Menschen zu Wort, die in ganz unterschiedlichen Kontexten mit Scham konfrontiert sind. Warum war dir diese Vielstimmigkeit wichtig, und wie hast du deine Gesprächspartner*innen ausgewählt?
Scham ist eine Lebensrealität von uns allen. Sich der Emotion theoretisch zu nähern und ihre vielen strukturellen Bedingtheiten aufzuzeigen, ist wichtig. Gleichzeitig wollte ich aber auch, dass die oft destruktive Seite der Scham im Leben einzelner Menschen sichtbar wird. Und Menschen in meinem Buch auch für sich selbst sprechen können – aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Teilweise sind das Personen, mit denen ich schon früher einmal für Artikel zu bestimmten Themen gesprochen hatte. Oder Personen, über die ich zufällig „gestolpert“ bin. Bei allen war mir aber wichtig, dass ich ihre Geschichte so wahrhaftig wie möglich erzähle.
Hat sich durch das Schreiben von „Scham“ dein Blick auf Sprache und Öffentlichkeit verändert – vielleicht sogar dein journalistisches Arbeiten?
Nein, das eher nicht. Während meines Studiums hatte ich mich bereits viel mit Sprache, Macht und Öffentlichkeit auseinandergesetzt. Allerdings hat sich mein Blick auf die Scham selbst nochmal verändert. Indem mir nochmal klarer geworden ist, dass die Scham keine inhärent „negative“ Emotion ist, sondern eigentlich sogar sehr produktiv sein kann – unter den richtigen Bedingungen, die ich eben auch im Buch versuche zu erklären.
Könntest du uns zwei oder drei Werke nennen, die dein Schreiben und deinen Werdegang als Autor geprägt haben?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde da zunächst „Effi Briest“ von Fontane nennen. Das Buch habe ich während meiner Zeit als Koch gelesen. Und der Umstand, dass es mir tatsächlich gut gefallen hat, hat mit dazu geführt, dass ich daraufhin mein Abitur auf einem Abendgymnasium nachgeholt habe. Lesen hatte vorher keinen Stellenwert in meinem Leben. Das zweite wäre wahrscheinlich „Das Unbehagen der Geschlechter“ von Judith Butler und/oder „Die Ordnung der Dinge“ von Foucault. Auch wenn ich inzwischen einige Aspekte der postmodernen Theorie kritisch sehe, haben diese und andere Werke mir während des Studiums sehr viel beigebracht. Zuletzt möchte ich noch „Knife“ von Salman Rushdie nennen, das auch in meinem Buch vorkommt. Und „Empusion“ von Olga Tokarczuk als das letzte Buch, das mich so richtig bewegt hat.

Scham
Matthias Kreienbrink gelingt mit Scham ein kluges und persönliches Sachbuch über ein Gefühl, das oft verdrängt wird, aber unser Leben tief prägt. Er analysiert nicht nur gesellschaftliche Beschämungsmechanismen, sondern zeigt auch, wie Scham produktiv werden kann – wenn wir ihr zuhören, statt sie zu bekämpfen. Durch biografische Offenheit und vielfältige Fallgeschichten entsteht ein ehrlicher Blick auf eine Emotion, die uns alle betrifft. Kreienbrink schreibt empathisch, ohne zu moralisieren – und macht spürbar, warum es heilsam sein kann, sich mit der eigenen Scham auszusöhnen.