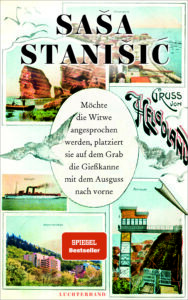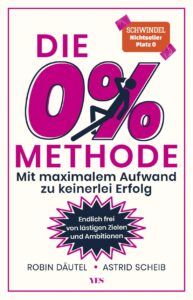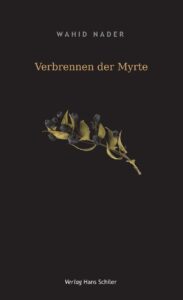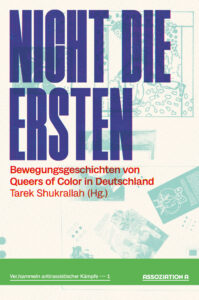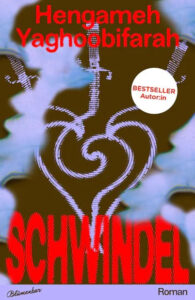Mein Name ist Omid Rezaee – freier Journalist, Buchenthusiast und dein persönlicher Buchkritiker. Willkommen zur 11. und letzten Ausgabe von migrantisch gelesen im Jahr 2024.
Die Feiertage stehen bevor – eine Zeit, die meiner Erfahrung nach für viele migrantisierte Menschen ambivalent ist. Ich erinnere mich an einige Weihnachten, an denen meine Mitbewohner*innen und Freund*innen verreist waren und die Festtage im Kreise ihrer Liebsten verbrachten. In diesen Momenten, wenn Einsamkeit besonders spürbar wird, waren es für mich vor allem Bücher und das Lesen, die mir geholfen haben. Sich in fiktive Welten, andere Universen und ferne Zeiten zu vertiefen, ist ein Fluchtweg aus der harten Realität der Einsamkeit.
Vor einigen Wochen habe ich mit einer Freundin über genau dieses Gefühl der Einsamkeit gesprochen, und sie hat mir das Buch „Allein“ von Daniel Schreiber empfohlen (ja, manchmal – wenn auch nicht oft – lasse ich mir Bücher empfehlen!). In diesem Buch beschäftigt sich Schreiber mit dem Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Spoiler: Der größte Unterschied liegt darin, dass man sich das Alleinsein aussucht, während die Einsamkeit einen überwältigt. Dieses Buch hat mir – als jemand, der gerne allein ist, aber gelegentlich von Einsamkeit übermannt wird – geholfen, bewusster mit diesem Gefühl umzugehen.

Daniel Schreiber widmet sich in seinem Buch „Allein“ einem der größten gesellschaftlichen Tabus unserer Zeit: dem Alleinsein. Dabei geht es nicht nur um die Einsamkeit, die als Schmerz empfunden wird, sondern auch um das Potenzial, das in der Selbstbestimmung liegt. Er nähert sich dem Thema mit einer seltenen Kombination aus persönlicher Offenheit und intellektueller Tiefe.
Das Buch bietet keine einfachen Antworten und ist kein Ratgeber. Vielmehr entfaltet es eine essayistische Reise, die sich mit philosophischen, soziologischen und literarischen Perspektiven ergänzt. Diese Vielfalt dient nicht als bloße Verzierung, sondern vertieft das Verständnis für das Spannungsfeld, in dem das Alleinsein steht: zwischen dem gesellschaftlichen Ideal der Paarbeziehung und der realen Erfahrung des Alleinlebens. „Allein“ ist ein Werk, das nicht nur die Lesenden berührt, sondern auch eine Reflexion über den Wert von Beziehungen, Freundschaften und Selbstfürsorge anstößt.
Seit diesem Sommer empfehle ich dir alle zwei Wochen Bücher und Autor*innen, die neue Perspektiven eröffnen und nicht selten Denkanstöße bieten. Zum Abschluss des Jahres 2024 möchte ich auf die Highlights dieses Newsletters zurückblicken – Bücher, die sich perfekt als entspannte, aber zugleich anspruchsvolle Lektüre für die Ferientage eignen.
Zuerst:
„Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne“ – eine Sammlung von Kurzgeschichten, die sich leicht lesen lässt und perfekt für ein entspanntes Lesevergnügen während der Ferien geeignet ist.
Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne
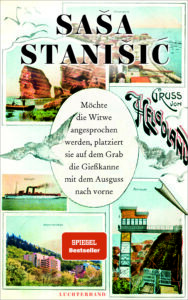
Schon der Titel lässt erahnen, mit welchem feinen Humor Stanišić selbst die ernsthaftesten Themen behandelt. Zur Erinnerung: 2019 wurde er für „Herkunft“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Zwar dreht sich sein neues Buch nicht direkt um die Frage der Identität, doch bereits das erste Kapitel trägt den Titel „Die neue Heimat“. Ganz losgelöst von diesem Thema sind die Geschichten also auch diesmal nicht.
Saša Stanišićs Erzählband changiert spielerisch zwischen Realität und Fiktion, Vergangenheit und Zukunft. In zwölf Geschichten entwirft Stanišić alternative Lebenswege und Szenarien, die von einer Kindheit in Heidelberg bis zu imaginären Reisen nach Helgoland reichen. Mit viel Witz und literarischer Raffinesse erkundet er das menschliche Streben nach einem besseren Leben, ohne dabei den scharfsinnigen Blick für die Härten des Alltags zu verlieren. Ein faszinierendes, komplexes Werk voller Tiefe und Humor.
Wenn ihr treue Leser*innen seid, wisst ihr, dass mein absolutes Highlight des Jahres der neue Roman von Olga Grjasnowa ist – ein ebenso humorvoller wie bitterer Roman über Familie und Identität.
Juli, August, September

In Olga Grjasnowas neuem Roman „Juli, August, September“ entfaltet sich ein Familiendrama, das von Berlin über Russland und Baku bis nach Jerusalem reicht und dabei deutsche Faschismusgeschichte, russischen Kommunismus und den zerstörerischen Neoliberalismus unserer Zeit miteinander verknüpft.
Und nun eine praktische Empfehlung: „Die 0%-Methode: Mit maximalem Aufwand zu keinerlei Erfolg“. Dieses Buch hilft euch, dem Erfolgswahnsinn unserer Zeit zu entkommen, die Dinge mit etwas Humor zu betrachten und auch mal entspannt Low-Performer*innen zu sein!
Die 0%-Methode
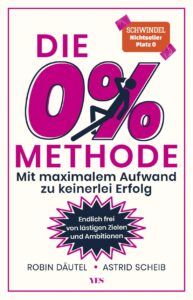
„Die 0%-Methode“ von Astrid Scheib und Robin Däutel nimmt auf humorvolle Weise den Trend zur Selbstoptimierung aufs Korn. Das fiktive Autor*innenduo feiert das Nichtstun als legitime Lebensweise und lädt Leser*innen ein, sich von gesellschaftlichen Zwängen wie Produktivität und Perfektionismus zu befreien. Mit ironischen Ratschlägen und überzeichneten Lebensgeschichten präsentieren sie das Scheitern als Erfolgsrezept und schaffen es, die Absurdität unserer Leistungsorientierung auf urkomische Weise zu entlarven – ein befreiendes Lesevergnügen für alle, die sich der Optimierungsfalle entziehen wollen.
Und für alle, die hier nichts Passendes finden, habe ich noch weitere Tipps: Die ZEIT hat eine Liste der besten 100 Bücher des Jahres veröffentlicht – einige davon habe ich in den letzten Monaten bereits für dich rezensiert. Außerdem bietet Zeit Online ein praktisches Tool, das dir anhand einiger Fragen den perfekten Roman für die Ferien empfiehlt. Und wirf unbedingt einen Blick in den Online-Shop von kohero. Dort verkaufen wir inzwischen viele spannende Bücher migrantischer Autor*innen – aufgrund der deutschen Buchpreisbindung kosten Bücher übrigens überall gleich viel. Einige der Bücher im Shop kennst du bereits aus diesem Newsletter, doch das Stöbern lohnt sich auf jeden Fall!
Mit diesem Newsletter versuche ich, einen neuen Blick auf die Literatur und den Literaturbetrieb zu werfen – und es scheint, dass dies nicht ganz erfolglos war. Im Laufe des Jahres haben sich unter anderem Behzad Karim Khani, Shida Bazyar, Olga Grjasnowa und Hengameh Yaghoobifarah indirekt an der Diskussion beteiligt. Im nächsten Jahr möchte ich diesen Ansatz weiter vertiefen und den deutschsprachigen Literaturbetrieb noch stärker aus migrantischer Perspektive beleuchten.
Ich wünsche dir erholsame Feiertage, inspirierende Lektüre und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Vielen Dank, dass du mich durch dieses Jahr begleitet hast – ich freue mich darauf, 2025 mit dir weiterzudenken, zu lesen und zu diskutieren!
Bis zum nächsten Jahr und liebe Grüße,
Euer Omid