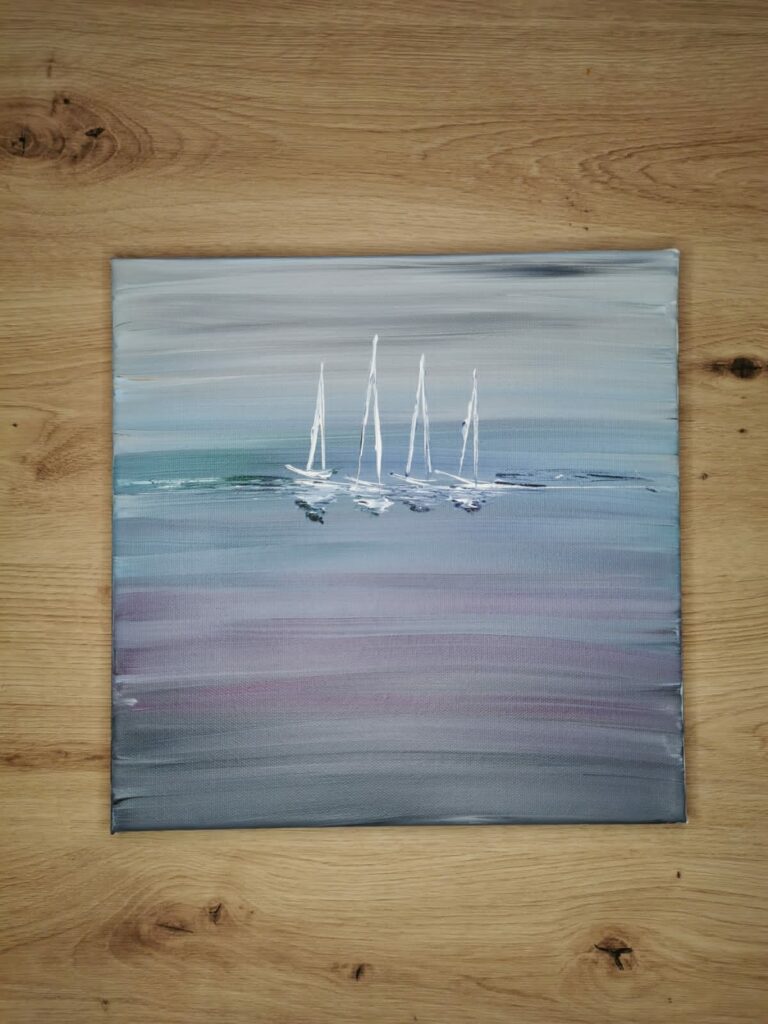Laut WHO bedarf es etwa 150 Minuten Bewegung oder 75 Minuten Sport in der Woche, um den Körper gesund zu halten. Daher ist regelmäßige Bewegung gesund, fördert die psychische Gesundheit und baut Stress ab.
Verbindung stärken durch Bewegung
Bei „Movimientos Auténticos“ geht es vor allem um Selbsterfahrung und Selbstermächtigung über die körperliche Bewegung „Bei uns geht es vor allem um Verbindung zu schaffen“, sagt Gründerin Jennifer Carmen Kubstin.
Jennifer Carmen Kubstin ist Tanzpädagogin, Yoga-Lehrerin und Sozialarbeiterin. Sie hat während ihres Auslandsemesters in Costa Rica damit angefangen, Tanz- und Yoga-Kurse für einheimische Frauen anzubieten „Mein Ziel war es, Frauen die Möglichkeit zu bieten, sich frei in einem geschützten Raum zu bewegen“ sagt Kubstin und ergänzt: „Wir arbeiten mit allen Frauen, denn über manche Themen können viele nicht reden, aber durch Bewegung und Tanzen lassen sie sich ausdrücken“.
Verbindung zum Körper erleben
2021 hat Kubstin ihren Verein in Bochum gegründet, und hat sich selbstständig als Tanzpädagogin und Yogalehrerin gemacht. „Mit unserem Angebot versuchen wir, die Verbindung zu sich selbst zu stärken, die Verbindung zum Körper zu erleben und dadurch das Körperbewusstsein achtsamer zu gestalten. Auch die Verbindung zwischen Körper und Psyche zu erkennen. Die Verbindung zu anderen Frauen und anderen Kulturen aufzubauen, sowie die Verbindung der unterschiedlichen Instanzen, Tanz, Yoga, und soziale Arbeit, zu nutzen“, erklärt sie.
Movimientos Auténticos setzt sich für Frauen Empowerment in Lateinamerika und Deutschland ein. Mit seinem Konzept geht es darum, mehr Wohlfühlen und Selbstliebe über den Körper, ganz besonders durch Tanz und Yoga, zu gewinnen. „In unseren Kursen und Workshops verbinden wir nicht nur Kulturen miteinander, sondern auch das Individuum mit sich selbst“, so die Tanzpädagogin, „unsere Keywords sind: Empowerment, Tanz, Interkulturalität, Yoga, Verbindung, Wohlfühlen“.
Interkulturellen Austausch schaffen
Als sie in Costa Rica war, hat Kubstin bemerkt, dass Frauen sehr gerne mit ihrem Körper arbeiten, und das sogar noch lieber als hier in Deutschland. „Daher habe ich gedacht, dass man so was super verbinden kann, praktisch, dass das Problem, was man erkannt hat, mit den Ressourcen, die vorherrschen“, sagt Kubstin gegenüber Kohero.
Kulturelle Unterschiede zwischen den Menschen sind ein Indiz für die Vielfalt dieser Welt. Aber viele Menschen kennen einander nicht und pflegen falsche Vorstellungen über die Kultur und Bräuche anderer Völker. So gelang es dem Projekt, mit Stereotypen aufzubrechen und ein korrektes Bild von Europa und Lateinamerika gegenseitig zu vermitteln.
„Ich finde diese Interkulturalität toll, weil mir aufgefallen ist, dass viele Menschen in Lateinamerika denken, dass wir in Europa die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Deshalb war es mir wichtig, den Menschen vor Ort zu zeigen, dass diese Stereotypen nicht richtig sind“, sagt Kubstin. „Jede Kultur auf dieser Welt hat ihre positive sowie negative Seite, und nur wenn wir uns miteinander austauschen, können wir besser voneinander lernen“ erläutert sie.
Ein Projekt für alle Frauen
Das Programm findet zurzeit parallel zweisprachig (Spanisch und Deutsch) statt und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen Ländern, Costa Rica, Mexico, Kolumbien und Nicaragua. Daher läuft das Programm Online und vor Ort.
„Die Inhalte sind dabei identisch, sodass jede genau das Gleiche mitbekommt. Währenddessen gibt es dann immer wieder gemeinsame Einheiten für alle Frauen, um in Kontakt und Austausch mit anderen Kulturen zu kommen. Dabei helfen Übersetzer*innen und diverse Übersetzungstools. Bei manchen Dingen, wie dem freien Tanz, unterstützt uns außerdem die körperliche Kommunikation“ erklärt die Sozialarbeiterin.
„Trotzdem richtet sich unser Programm insbesondere hier in Deutschland an alle Frauen, unabhängig davon welche Sprache sie sprechen. Also, Frauen aus arabischen Ländern gehören auch zu unserer Zielgruppe. Denn das Projekt ist nicht ausschließlich für Frauen aus Deutschland oder aus Lateinamerika, sondern es ist für alle Frauen offen“, ergänzt sie.
Kulturelle Aneignung und Yoga
Kritiker*innen sind der Meinung, dass die Yoga-Philosophie von der westlichen Welt geklaut wurde, und damit wurde diese Kultur den westlichen Bedürfnissen angepasst (Mehr dazu hört ihr in unserm Curry On-Podcast). Damit ist Yoga nahezu ein Beispiel zur kulturellen Aneignung. Dieser Diskurs findet heutzutage auch in Deutschland statt.
„Ich finde, dass all diese kritische Dinge zur kulturellen Aneignung irgendwo auch seine Grenzen haben. Denn ich glaube, dass man sogar bis zu einem gewissen Punkt bremsen kann, wenn man sich zu einer anderen Kultur verbinden möchte. Daher hat Yoga es heutzutage geschafft, unterschiedliche Kulturen miteinander zu verbinden“, sagt Yoga-Lehrerin und ergänzt:
„Ich mag die ganze Philosophie des Yogas sehr. Diese Philosophie verbindet den Menschen mit der Umwelt, den Menschen mit sich selbst und den Menschen zu anderen Menschen sowie den Menschen zu anderen Kulturen. Und um diese Verbindung geht es eigentlich bei uns“.
Doch findet Kubstin, dass dieser Kritik berechtigt sei „ich habe es noch nie erlebt, dass jemand mich wegen der kulturellen Aneignung im Yoga angesprochen hat. Aber wenn jemand zu mir kommt und mir sagt: das ist eine kulturelle Aneignung, dann würde ich gerne darüber nachdenken und etwas ändern. Ansonsten versuche ich mit meinem Herzen daran zu gehen“, erläutert sie.
Ehrenamtliches Team und kostenlose Angebote
Das Team des Vereins arbeitet ehrenamtlich und seine Kurse sind von Spendengeldern finanziert „Allen Personen, die aktuell die Gebühren des Kurses nicht zahlen können, bieten wir Stipendien an. Und wenn man sich über die Summe unsicher ist, kann man zahlen, was sich entsprechend gut anfühlt“, so Kubstin.
„In Lateinamerika arbeiten wir unter anderem mit sozialen Einrichtungen zusammen, die uns beim Kontakt zu den Frauen vor Ort und bei der Übertragung des Programms unterstützen. Die meisten dieser Frauen werden kostenfrei teilnehmen. Deswegen ist die Finanzierung über die Crowdfunding Kampagne ein Gewinn für uns“, sagt sie weiter.
Hier könnt ihr einen weiteren Artikel über Yoga lesen.