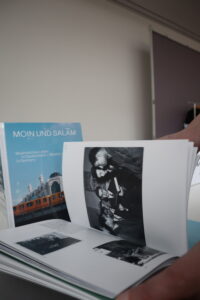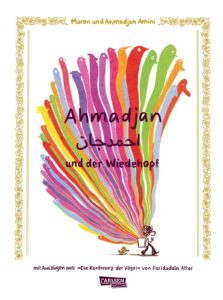Sobald man die Tanzfläche des Lido’s in Berlin-Kreuzberg betritt, vibriert der Bass durch den ganzen Körper. Auf der Tanzfläche schreit eine Gruppe Frauen zu einem House-Remix von Nancy Ajram mit. Als der nächste Song mit einem Dabke-Rhythmus einsetzt, bildet sich ein großer Kreis, in dem die Menge gemeinsam tanzt. Die Energie ist ansteckend.
Diese Energie trägt einen Namen: Sahra – arabisch für Ausgehen. Die queer-feministische Partyreihe findet regelmäßig in Berlin statt und ist eine der ersten ihrer Art, die arabische Popmusik, elektronische Beats und queere-feministische Werte miteinander verbindet. Gründerin Nour hat mit Sahra einen Raum für Sichtbarkeit und Empowerment geschaffen.
„The best of both worlds“
Sahra begann als eine Reihe von Geburtstagspartys. Mittlerweile hat sich die Party zu einer festen Größe im Berliner Nachtleben entwickelt und wurde 2024 sogar mit dem Berliner Club Award für Newcomer ausgezeichnet. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach: Viele Clubs hatten zunächst Bedenken, ein Event mit arabischer Musik an einem Wochenende zu hosten. Doch Nour und ihr Team haben sich nicht entmutigen lassen und schufen mit Sahra eine einzigartige Veranstaltungsreihe.
Die Partys vereinen elektronische Musik mit arabischem Pop und traditionellen Rhythmen – „the best of both worlds“, wie Nour es nennt. Aber Sahra ist weit mehr als nur Musik. Die Partys sind auch ein Ort der Begegnung und Kreativität. Mit einem Line-up aus arabischen DJs aus Berlin und der internationalen Szene entsteht eine besondere Atmosphäre. Eine Atmosphäre in der Melodik, Bass und Nostalgie verschmelzen. Sahra prägt ein neues internationales Musikgenre: „Electro Swana‘“ – ein Begriff, der die Region Südwestasien und Nordafrika (Swana) aus einer antikolonialistischen Perspektive beschreibt.
Teil des Sahra-Kollektivs ist Hiba Salameh, eine DJ und Musikproduzentin aus Haifa. Laut dem Musikmagazin Mixmag gehört sie zu den palästinensischen DJs, die man unbedingt kennen sollte. Auch Rizan Said, ein syrischer Komponist und Produzent, hat die Bühne von Sahra bereits betreten. Seine Stücke prägen die syrische Musikszene bis heute, und er hat in der Vergangenheit eng mit der Musikikone Omar Souleyman zusammengearbeitet.
Doch es sind nicht nur bekannte Namen, die Sahra ausmachen. Besonders stolz ist Nour auf eine Veranstaltung, bei der das gesamte Line-up aus Frauen bestand: „Kommt für eine Nacht vorbei und hört arabischen Frauen zu! Sie machen ihr Ding und haben den Club ausverkauft.“ Es geht um Sichtbarkeit!
Ein sicherer Raum für alle
Was Sahra so besonders macht, ist der Raum, der erschaffen wird: ein sicherer Ort für Menschen, die in der Clubszene oft marginalisiert werden. Hier können sie frei und ohne Vorurteile sie selbst sein. Ein ausgebildetes Awareness-Team sorgt dafür, dass alle Gäste sich sicher und respektiert fühlen.
Seit der Entstehung von Sahra war die Vision, einen solchen Raum zu schaffen, ein zentraler Bestandteil des Konzepts. In dem angespannten politischen Klima, das in den letzten Monaten in Deutschland zunimmt, ist die Schaffung solcher Räume so wichtig. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen fällt es vielen von uns schwer, sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Durch einen Abend bei Sahra lösen sich diese Ängste und Sorgen vielleicht nicht vollständig auf, aber er schenkt uns Momente, in denen wir Teil einer Gemeinschaft sind – gesehen, gehört und respektiert. Es ist dieses Gefühl von Zusammenhalt, das Kraft und Motivation gibt. Nur als Community, nur gemeinsam, können wir diesen Zeiten begegnen und einen Weg nach vorne finden. Sahra ist ein Ort der Hoffnung in einer Zeit, in der Gemeinschaft und Solidarität hart auf die Probe gestellt werden.
Sahra beendet das Jahr mit einigen Highlights: einem Festival, der ersten internationalen Veranstaltung in Paris und einer Kollaborationsparty mit der amerikanischen Partyreihe Disco Tehran. Für das kommende Jahr können wir uns auf viele spannende Projekte freuen!
„Wir haben große Pläne für Bookings, Events und internationale Kollaborationen“, verrät Nour begeistert.
Der Artikel war eigentlich schon fertig und dann kam das plötzliche Update aus Syrien: Das Assad Regime ist gefallen. Nun ist das unvorstellbar passiert: die erste Sahra Party in Damaskus im Januar 2025. Nour berichtete von ihrer Erfahrung: „Selbst als die Veranstaltung begann, war es schwer zu glauben, dass wir wirklich dort waren – zurück in Damaskus, einer Stadt, die viele von uns seit über einem Jahrzehnt nicht mehr betreten hatten. So lange hatten wir nicht geglaubt, dass dieser Moment jemals eintreten würde, und doch waren wir da und tanzten zu den Liedern der Revolution im Herzen der Hauptstadt. SAHRA in Damaskus war mehr als ein Fest; es war ein Akt der Zurückgewinnung von Raum und Identität, bei dem sich Freude, Trauer und Hoffnung vermischten. Gemeinsam ehrten wir die Vergangenheit, feierten die Freiheit und hielten an dem gemeinsamen Traum von einer besseren Zukunft fest.“