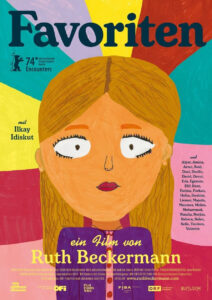Leider geht meine Reise beim kohero Magazin nach über einem Jahr und über fünfundzwanzig Ausgaben erst einmal zu Ende. Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen und meinem Redakteur für die gute und angenehme Zusammenarbeit sowie die absolute Freiheit, über alles Mögliche schreiben zu dürfen. Diese Freiheit ist natürlich nicht selbstverständlich im deutschen Journalismus. Ich bedanke mich auch bei allen Leser*innen des Newsletters, für das Lesen, für das Kommentieren, für das Feedback, für die E-Mails. Ich hoffe, die eine oder andere Film- oder Serienempfehlung war erfolgreich und der Newsletter konnte euch darüber hinaus alle zwei Wochen (gut, manchmal waren es auch mehr als zwei Wochen) zum Denken anregen.
Wenn du dich weiterhin mit mir zu Film und Fernsehen (oder anderen Themen) austauschen möchtest, dann folg mir gerne bei Instagram @schayanriaz. In Kürze werde ich auch auf Substack aktiver sein, wo ich regelmäßiger über aktuelle und alte Filme schreiben werde: schayanriaz.substack.com.
Bis dahin, pass auf dich auf und seid alle nett zueinander — wir sehen uns im Kino!
Dein Schayan
FAVOURITE FILMS OF 2024
Ein paar Tipps bekommst du dieses Mal aber noch: Wie letztes Jahr habe ich auch dieses Jahr meine Lieblingsfilme bei Instagram geteilt und wie letztes Jahr werde ich sie auch dieses Jahr im Newsletter teilen.
Selbstverständlich ist mir erst nach dem Teilen aufgefallen, dass ein Film, der mir letztes Jahr sehr gut gefallen hat, fehlt: SHAMBHALA von Min Bahadur Bham. Das beweist einmal mehr, wie Endjahreslisten „not that deep“ sind und darüber hinaus auch Wochen später veränderbar sind.

BERLINALE BOYKOTT?
In Deutschland gilt es als das größte Filmevent des Jahres, doch in diesem Jahr ist alles etwas anders. Denn bei der letzten Preisverleihung der Berlinale gab es 2024 einen peinlichen, sehr — anders kann man es nicht nennen — deutschen Eklat: Der Film „No Other Land“ eines palästinensisch-israelischen Kollektivs um die beiden Regisseure Yuval Abraham (aus Israel) und Basel Adra (aus Palästina) gewann den Preis für den Besten Dokumentarfilm.
Während noch im Frühjahr 2024 Bomben auf den Gazastreifen fielen, appellierten die beiden Filmemacher an deutsche Politiker*innen im Saal und generell an die deutsche Regierung, Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen. Es gab tosenden Beifall im Saal, auch von Politiker*innen, doch im Nachhinein wurden die Gewinnerreden als antisemitisch gebrandmarkt, Noch-Kulturministerin Claudia Roth sagte, sie habe nur für den israelischen Regisseur geklatscht. Der Film ist nun für einen Oscar nominiert.
Es ist fast ein Jahr vergangen seit dieser absurden deutschen Episode, und es ist viel Schlimmeres passiert in der Zwischenzeit: allen voran ein Genozid in Gaza, aber auch viele weitere Tote im Westjordanland, und im Libanon. Zwar herrscht eine Waffenruhe, die notwendig ist für die Rückkehr von Geiseln, sowohl israelische als auch palästinensische, doch niemand kann diesen Entwicklungen so wirklich trauen, erst recht nicht mit Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten (der am Dienstag angekündigt hatte, Gaza zum Eigentum der USA zu machen und alle Menschen dort zu vertreiben).
Das Timing der diesjährigen Berlinale ist also etwas unpassend — die BDS-Bewegung hat bereits zum Boykott aufgerufen. Zum einen wegen der ganzen Debatte um „No Other Land“ und weil deutsche Politiker*innen Basel Adra und Yuval Abraham in den Rücken gefallen sind. Und zum anderen — viel ausschlaggebender —, weil Deutschland den Genozid in Israel aktiv unterstützt hat. Ende letztes Jahr hat die Berlinale selbst einen Mitarbeiter entlassen, weil dieser intern eine Nachricht mit dem Slogan „From the River to the Sea“ verschickte. Die Details sind nicht ganz klar, aber warum die Berlinale-Leitung so etwas nötig hat, die übrigens von Anfang an hinter „No Other Land“ steht, ist mir ein Rätsel.
Ich bin gespannt, wie sich der Boykott während der Berlinale zeigen wird. Diese ja weitaus mehr ist als nur die Film-Screenings und Preisverleihungen, sondern auch eine Möglichkeit zum Netzwerken. Es läuft auch dieses Mal ein palästinensischer Dokumentarfilm über Gaza im Programm, darüber hinaus aber auch zwei Dokumentationen über rechte und rassistische Anschläge in Hanau und Mölln und ein Film über den Krieg im Sudan. Mal sehen, wie sich das alles entwickeln wird.
PALÄSTINENSISCHE STIMMEN
Etwas on topic, frage ich mich seit Längerem, wie man seit dem 7. Oktober 2023 und insbesondere aufgrund des Totalausfalls der Menschlichkeit in weiten Teilen der Film- und Fernsehindustrie Medien konsumieren soll. Immer wieder werden Filmtitel angekündigt — mit Schauspieler*innen, die vor ein paar Monaten noch das Leid von Menschen in Palästina geleugnet haben. Immer wieder starten Serien mit Persönlichkeiten, die ihren Zionismus stolz in den sozialen Medien zur Schau gestellt haben. Und jetzt, wo die Awards Season stattfindet, werden immer wieder Menschen zu Themen wie Akzeptanz und Diversität interviewt, die vor ein paar Monaten noch keine Meinung zu Israel und Palästina hatten und das alles ganz einfach ignoriert haben.
In der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Mo“, eine der wenigen Serien, wenn nicht die einzige amerikanische Serie, mit einem palästinensischen Hauptdarsteller, wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Gleich in der ersten Folge geht es um den „Konflikt“, doch es ist ja eigentlich gar kein Konflikt, wie es Mo (Comedian Mo Amer, spielt hier eine Version von sich) dem US-Botschafter in Mexiko zu erklären versucht. Es ist eine illegale Besatzung von Palästina durch Israel. Der Politiker wird das nicht akzeptieren (was an Politiker*innen hierzulande erinnert).
In der letzten Folge der Staffel geht es dann zum Westjordanland, wo die Entmenschlichung, die vielen Checkpoints, die Siedlergewalt thematisiert wird. Ich weiß, „Mo“ ist keine perfekte Show, aber wenn ich wieder zurück zu meiner Anfangsfrage komme, wie man Kunst konsumieren soll, die das Thema Israel–Palästina behandelt und das in einer Weise, die ehrlich und authentisch ist, dann ist „Mo“ ein Lichtblick in düsteren Zeiten. Insbesondere wegen des Erzählbogens zum Ende hin.

Still aus dem Film Mo
NEU IM KINO: Soundtrack to a Coup d’Etat
Meine letzte roots & reels-Kinoempfehlung — und die hat es wirklich in sich, weil hier alle Sachen kombiniert werden, für die dieser Newsletter immer stehen sollte: „Soundtrack to a Coup d’Etat“ des belgischen Filmkünstlers Johan Grimonperez ist eine intelligente und fieberhafte Auseinandersetzung mit den 1960-Jahren, als immer mehr afrikanische Staaten sich im Zuge des Kalten Krieges gegen ihre europäischen Kolonialmächte aufgelehnt haben.
Ein großer Fokus liegt dabei auf Patrice Lumumba, den ersten Premier des unabhängigen Kongo. Und außerdem darauf, wie die CIA und weitere Verbündete Jazz als imperialistisches Instrument eingesetzt haben, nämlich Schwarze Größen wie Louis Armstrong, Dizzy Gillespie oder Duke Ellington auf Tour geschickt haben, um nebenbei Ermordungen von afrikanischen Staatsoberhäuptern zu planen. Es ist eine faszinierende Zeitkapsel über die Dekolonisierung und Plünderung Afrikas durch den Westen und liefert aktuelle Verbindungslinien zu Kongo heute, mit einem nachdrücklichen Soundtrack.