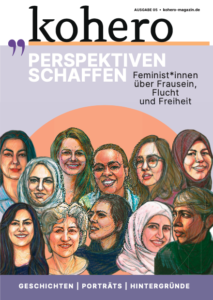Was hat Sie zunächst dazu bewegt, sich politisch zu engagieren?
Am Anfang war es vor allem, dass mir aufgefallen ist, dass es eine starke Diskrepanz zwischen dem gibt, was im gesellschaftlichen Diskurs verhandelt wird, wenn es um den Islam geht, und dem was ich wahrnehme in meiner persönlichen Lebensrealität und der muslimischen Community. Diese Diskrepanz war eklatant.
Es stört einen, beobachten zu müssen, dass es da teilweise Wissensdefizite gibt. Und dass Menschen, die wenig mit dem Islam zu tun haben, über den Islam schreiben ohne mit Muslimen gesprochen zu haben. Ich habe dieses Problem gesehen und daraus ist ein Bedürfnis entstanden, eine andere Perspektive in den Diskurs einzubringen. Um zu zeigen, wie vielschichtig die Realität ist und wie abgehoben und einseitig die Debatten sind.
Was bedeutet Ihnen dabei Feminismus?
So wie ich den Feminismus verstehe, geht es um Gerechtigkeit für alle. Der Feminismus ist für mich der Einsatz für eine gerechtere Welt und das deckt sich auch ganz stark mit meinem Verständnis vom Islam. Der Islam und auch der Koran betonen immer wieder, dass Gerechtigkeit das oberste Prinzip des Handels sein muss.
Nichtsdestotrotz scheint es für viele erstmal ein widersprüchliches Bild zu sein, dass man Muslima und Feministin ist. Wie passt das und warum denken Sie, ist das für viele noch so abwegig?
Es gibt tatsächlich einen Ist-Zustand in Teilen der sogenannten islamischen Welt, wo es ganz real eine Diskriminierung von Frauen gibt. Diese Diskriminierung, die teilweise in muslimischen Ländern stattfindet, wird dann gleichgesetzt mit der Weltreligion des Islams. Das was in der Praxis an Ungerechtigkeit passiert, wird sofort mit dem Islam als Lehre verknüpft. Es gibt aber einen Unterschied zwischen dem, was Muslime tun und dem was eine Weltreligion als Werte und Norme bereithält.
Wenn einem das klar geworden ist, muss man sich die Quellen des Islams und die frühislamische Geschichte anschauen. Da wird man schnell feststellen, dass, als der Islam entstanden ist, dieser eine sehr Frauen empowernde Religion war. Er ist zu einem Zeitpunkt entstanden, zu dem Frauen unterdrückt worden sind. In diesem Kontext hat der Koran immer wieder wertgelegt auf Frauenrechte, wie das Recht auf Bildung und vieles mehr. Diese waren eine soziale Revolution, die mit dem Islam gekommen ist. Mit diesem Wissen versteht man, warum der Islam und Feminismus etwas miteinander zutun haben.
Glauben Sie, dass es im Islam eine Veränderung braucht, um diesem Bild des Fortschritts immer noch zu entsprechen?
Ja und das ist das große Problem. Wir haben teilweise innerhalb des Islams eine anachronistische Entwicklung. Als der Islam entstanden ist, war dieser eine sehr progressive Religion. Dass Frauenrechte mit Füßen getreten werden und auch eine Auslegung des Islams immer weiter Verbreitung findet, die frauenfeindlich ist, zeigt, dass es heute teilweise Muslime gibt, die sich genau in die gegenläufige Richtung bewegen.
Das macht es schwierig, weil es dazu führt, dass wir uns genau anschauen müssen, was es für unterschiedliche Auslegungen des Islams gibt. Und was Muslime aus den Quellen des Islams machen. Es gibt eben auch den Missbrauch. Das ist ganz klar und das muss man auch thematisieren.
Das ist unter anderem auch die Aufgabe einer muslimischen Feministin. Sie muss darauf hinweisen, dass im Laufe der Geschichte Männer versucht haben die Religion des Islams für sich zu instrumentalisieren, um Frauen zu unterdrücken und patriarchale Strukturen zu verfestigen.
Wie trägt der Islam zu einem emanzipierten Frauenbild bei?
Im Islam ist viel angelegt, was als Außenstehender vielleicht auf den ersten Blick irritieren kann. Wenn man es aber im Alltag praktiziert, empfindet man diese Dinge als sehr empowernd. Es gibt beispielsweise schon immer spezielle Frauenräume. Heute würde man vielleicht von Safe Spaces sprechen. In bestimmten Alltagssituation gibt es also abgeschlossene Räume, zu denen Männer keinen Zugang haben. Im Zuge der Kolonialisierung wurde oft behauptet, dass diese Räume diskriminierend wären. Der eigentliche Hintergrund ist allerdings, dass es eben Räume gibt, in denen Frauen sich ungezwungen und ohne Belästigung verwirklichen können.
Deswegen muss man auch verstehen, dass diese Form von Safe Spaces im Islam schon sehr früh angelegt war und von Frauen auch als bestärkend empfunden wurde, weil diese ohne sich gegenüber Männern durchsetzen zu müssen, immer ihre Räume hatten. Das haben dann auch Frauenbewegungen in den 70ern in Deutschland wieder entdeckt. Dort ist es als empowernd wahrgenommen worden. Aber immer dann, wenn es zusammen mit dem Islam Erwähnung findet, gilt es als Zeichen der Unterdrückung. Wir sind gar nicht in der Lage zu sehen, dass diese Dinge für muslimische Frauen etwas Positives darstellen.
Warum glauben Sie, wird das Kopftuch auch heute noch von vielen als Symbol der Unterdrückung wahrgenommen?
In Paulusbriefen an die Korinther heißt es, dass die christliche Frau ihren Kopf bedecken soll, als Zeichen, dass sie dem Mann unterlegen ist. Da wird diese Assoziation, dass das Tragen eines Kopftuchs etwas mit Unterdrückung zu tun hätte, aufgemacht. Das stammt aber aus dem Christentum und deckt sich mit dem Islam somit nicht. Im Koran ist das Kopftuch als Erkennungszeichen und Schutz für muslimische Frauen beschrieben.
Ein weiterer Grund ist aber auch, dass das Kopftuch im Zuge der iranischen Revolution 1979 tatsächlich zu einem politischen Symbol gemacht wurde. Es gab Extremisten, die Religion und Politik verbinden wollten, um politische Interessen durchzusetzen. Und diese haben eben auch das Kopftuch genutzt.
Feminist*innen auf der ganzen Welt haben dann versucht zu bekämpfen, dass Frauen ein Kopftuch tragen müssen. Denn genau da fängt das Problem an: Wenn es einen staatlichen Zwang gibt, sodass der Mensch nicht frei ist in seiner Religionsausübung. Das deckt sich gar nicht mit dem Islam. Dennoch führen diese Elemente dazu, dass das Kopftuch für manche als Symbol der Unterdrückung gilt.
Worin liegt die emanzipatorische Stärke im Tragen eines Kopftuchs?
Wenn muslimische Frauen das Kopftuch heutzutage tragen, dann wollen Sie sich diese Bedeutung wieder zurückerobern. Sie wollen nicht zulassen, dass Extremisten oder die Fremdwahrnehmung bestimmen, wie sie das Kopftuch für sich definieren. Für muslimische Frauen in Deutschland, wo sie frei wählen können, ob sie eins tragen wollen oder nicht, hat das Kopftuch vor allem eine spirituelle Bedeutung. Es ist ein Kleidungsstück, was zutiefst mit der Beziehung zu Gott verbunden ist.
Es geht auf keinen Fall darum, dass sich jemand von außen einmischt, sondern im Gegenteil: Man möchte sich freimachen von dem Urteil, was von außen sein könnte. Man findet Freiheit indem man eine Beziehung zu Gott aufbaut und keine Anerkennung mehr von außen braucht, sondern Zufriedenheit in dieser Beziehung erfährt. Genau das kann sehr empowernd sein.
Islamkritiker*innen bemängeln, dass man vor allem bei jüngeren Mädchen, die ein Kopftuch tragen, nicht von Selbstbestimmung reden könne. Was hätten Sie dem zu entgegnen?
Wir sind alle davon beeinflusst wie unsere Eltern uns erziehen. Insofern sind alle, also nicht nur muslimische Mädchen, die ein Kopftuch tragen, beeinflusst. Letztendlich werden junge Frauen, die keine muslimische Erziehung erfahren, auch mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die nicht gerade feministisch sind. Denen gestehen wir aber zu, dass sie eine freie Wahl treffen und bei muslimischen Mädchen glauben wir, dass allein die Erziehung der Eltern so viel bewirkt. Meine Erfahrung ist eher das Gegenteil. Oft überlegen muslimische Mädchen beispielsweise das Kopftuch lieber nicht zu tragen, aus Angst vor Ausgrenzung und Diskriminierung.
Man muss junge Frauen stärken und zeigen, dass es ein Zeichen von Freiheit sein kann, wenn man sich nicht so verhält, dass es anderen gefällt. Man sollte sich selbst treu bleiben, auch wenn Druck aus egal welcher Richtung kommt.
Sind muslimische Frauen anderen Formen von Diskriminierung ausgesetzt, als Frauen, die weltliche, also säkulare Feminist*innen sind?
Teilweise gibt es natürlich Überschneidungen. Aber es gibt eben auch ganz klare Unterschiede zwischen den Diskriminierungserfahrungen. Sind Menschen von mehreren Formen von Diskriminierung betroffen, dann potenzieren sich diese, weil man z.B. nicht nur als Frau, sondern auch als Schwarze oder wegen seines Kopftuchs unterschiedlichste Diskriminierungserfahrungen macht.
Neben der Diskriminierung wird aber auch der Feminismus immer anders ausgelegt und verstanden. Es kann sehr spannend sein, wenn man sich anschaut, was eigentlich einen muslimischen und säkularen Feminismus unterscheidet und wo man sich bereichern könnte oder es aber Diskussionsbedarf gibt.
So weit sind wir aber noch gar nicht. Wir reden immer noch darüber, ob der Islam überhaupt mit dem Feminismus vereinbar ist und im zweiten Schritt reden wir dann über die Diskriminierung. Aber ich fände es auch ganz schön, wenn muslimische Frauen nicht immer nur im Kontext einer Opferrolle diskutiert werden, sondern dass man es auch als Bereicherung empfindet, wenn sie aus neuen Perspektiven Impulse in die Diskussion einbringen.
Warum glauben Sie, wird die muslimische Frau so häufig in diese Opferrolle gedrängt?
Sie ist Teil einer Minderheit und hat deshalb eine marginalisierte Position inne. Wenn man sie in den Diskurs reinholt, dann oft nicht als eine, der man auf Augenhöhe begegnet. Man gesteht der muslimischen Frau nicht zu, aus einer privilegierten Position als Gleichgestellte mitzureden. Wenn man sie bei Debatten in die Runde reinholt, dann selten auf Grund ihres Sachverstandes oder einer Expertise, sondern leider noch immer zu häufig, weil sie aus der Betroffenenperspektive sprechen soll. Das kann es nicht sein.
Es ist erst dann eine Selbstverständlichkeit geworden, dass muslimische Frauen Teil dieser Gesellschaft sind, wenn sie selbstverständlich in allen Bereichen mitsprechen und angehört werden.
Haben Sie selbst mit dieser Reduzierung auf Ihren Betroffenheitsstatus Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist ganz oft so gewesen. Früher stärker als heute, weil man sich im Laufe der Zeit dagegen wehren kann. Aber gerade Medien haben Interesse daran, von schlimmen Erfahrungen zu hören, weil sich diese gut verkaufen lassen. Das sorgt für Aufmerksamkeit und Klicks. Aber letztendlich hilft es den Betroffenen nicht weiter. Es kann für das Thema sensibilisieren. Aber Betroffene werden nicht auf Augenhöhe angehört, sondern sie sind weiterhin nur Gegenstand der Debatte ohne ein/e Teilnehmer*in zu sein.
In welchem Sinne geht es beim islamischen Feminismus also auch um Integration und die soziale Teilhabe der muslimischen Frau?
Das ist gerade das paradoxe. Seit Jahrzehnten werden muslimischen Frauen, insbesondere wenn es um das Kopftuch geht, wichtige Positionen auf dem Arbeitsmarkt verweigert. Lange hatten wir beispielsweise die Debatte um das Kopftuch der muslimischen Lehrerin. Da wird dann gesagt, dass das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung sei, sodass Frauen mit Kopftuch nicht Lehrerin werden dürfen. Man merkt gar nicht, dass das ein Widerspruch ist.
Man wird zum Unterdrücker und macht das Kopftuch zu einem Symbol der Unterdrückung, wenn man einer Frau deshalb den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. Dass man dabei um ein feministisches Argument bemüht ist, ist absurd.
Es geht denjenigen, die gegen das Kopftuch argumentieren, nicht wirklich um die Chancengleichheit von muslimischen Frauen. Das feministische Argument wird vorgeschoben, um einen dahinter liegenden Rassismus unkenntlich zu machen. Diese Taktik muss man aufdecken. Studien zeigen, dass muslimische Frauen sogar bei identischer Bewerbungen viel seltener zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden oder letztendlich einen Job bekommen. Da haben wir eine klare, harte Diskriminierung.
Was muss sich also an der Einstellung unserer Gesellschaft gegenüber der muslimischen Frau noch ändern?
Da muss leider noch sehr viel passieren. Mit dem 11. September hat eine rückläufige Entwicklung begonnen. Das Erstarken der AfD zeigt, dass wir auch in der Mitte unserer Gesellschaft antimuslimische Ressentiments haben. Rassistische Denkweisen sind tief in der Gesellschaft verankert und es sind auch normale Menschen, die es muslimischen Frauen sehr schwer machen. Meine Hoffnung ist, dass es sich in der jüngeren Generation verbessert, weil man da einfach viel mehr Kontakt mit Muslim*innen und kopftuchtragenden Frauen hat. So merkt man, dass das kein Problem ist.
Ein Kämpfen für mehr Chancengleichheit in den Strukturen beginnt mit dem Schaffen von Awareness. Vielleicht muss man aber auch über Quoten nachdenken, sodass solche Dinge hoffentlich dazu führen, dass wir da in einigen Generation als Gesellschaft weiter sind.
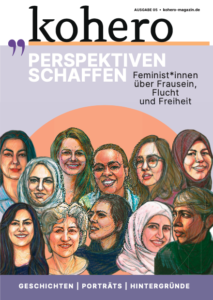
Du willst mehr über ungewöhnliche Geschichten von Feminist*innen lesen?
In unserem aktuellen Magazin PERSPEKTIVEN SCHAFFEN
erwarten dich spannende und bewegende Geschichten aus Deutschland und der Welt.
Selber lesen oder verschenken:
Einfach per mail an abo@koheromagazin.de