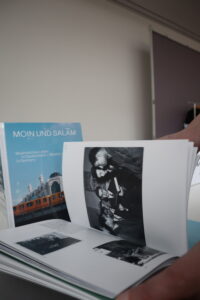Die Fenster stehen offen, Regen prasselt auf den Betonboden eines fast leeren Raums. Das kahle weiß der Wände wirkt steril, fast trotzig. Auf dem Boden: Objekte, die nicht erklären wollen, was sie sind. Ist das eine Leiter? Holz? Metall? Ich stehe im mittleren von drei Räumen. Sie bilden die Ausstellung „A Dry Mouth“ im Hamburger Frappant e.V., einer Zusammenarbeit von Razan Sabbagh, Remi Alkhiami und Laura Mahnke.
Der Raum, aus dem ich komme: rot. Der Raum, der vor mir liegt: grau. Gerade als ich mich umdrehe – weg vom Fenster, hin zu dieser fast-Leiter –, passiert es: Das Regenprasseln schwillt plötzlich stark an. Ich drehe mich um – das Geräusch kommt nicht mehr nur von draußen. Aus zwei kleinen schwarzen Lautsprechern, ein riesiges leuchtend blaues Kissen flankend, strömt Ton. Und was für einer. Der Regen wird zum Fluss, zur Welle, zur Flut. Stimmen mischen sich unter das Wasser – Nachrichtenschnipsel, Warnungen, Zitate: “Migration Wave”, “Decolonization”, “Crisis” wiederholt, mal verzerrt, mal geflüstert, mal fast geschrien. Es ist der erste von vielen Momenten in dieser Ausstellung, in denen ich denke: Ich verstehe nicht ganz, was ich bei dem Sonic Essay von Razan Sabbagh „Bodies of Waves“ sehe und höre – aber ich fühle etwas. Später erfahre ich, genau das ist die Idee.
Ein Titel voller Dissonanz
Der Ausstellungstitel „A Dry Mouth“ weckt Assoziationen von Trockenheit, Sprachlosigkeit, Staub – und steht im Kontrast zur sinnlichen Klangflut, die einen empfängt. Genau diese Reibung ist beabsichtigt: Der trockene Mund steht symbolisch für Erschöpfung, für das Gefühl, in der politischen Gegenwart nichts mehr sagen zu können. Die Ausstellung versteht sich als Gegenflut – aus Klang, Bewegung, Erinnerung und politischen Impulsen.
Ziel ist nicht sofortiges Verstehen, sondern emotionales Erleben: Irritation, Empathie, Unruhe, Nähe. Die Kunst stellt Fragen und gibt keine Antworten. Sie will berühren und anregen, zeigen: Auch ein trockener Mund kann Wellen schlagen.
Drei Künstlerinnen – drei Perspektiven
Razan Sabbagh und Remi Alkhiami kommen aus Syrien, Laura Mahnke aus Deutschland. Was sie eint, ist das gemeinsame Bedürfnis nach solidarischem Miteinander – nicht trotz, sondern wegen ihrer unterschiedlichen Biografien. Sie fragen: Wie können wir einander zuhören? Was bedeutet Solidarität in einer politischen Dürre?
Im ersten Raum, dem roten, fällt ein großformatiges Textilbanner ins Auge: „Decolonization looks good on white walls“ steht in kräftigem Rot auf schwarzem Stoff. Daneben, auf dem Boden, präsentiert Laura Mahnke rätselhafte Fake-Lederabdrücke keramischer Objekte – reduziert, fast bizarr. Razan sagt über Laura: „Sie hat diese Illusion in ihrer Arbeit: Man guckt drauf und weiß nicht so recht: Was ist das, was ich da sehe?“
Im mittleren, weißen Raum arbeitet Razan mit Ton, Sprache und Klang. Ihr Werk hat politische Tiefe, ist poetisch und vielschichtig. In ihrem „sonic essay“ verarbeitet sie historische Tonquellen, Medienbilder und die Kritik an Kolonialismus zu einer vielstimmigen Klanginstallation. Ein Lied aus den 1920ern, gesungen von versklavten Menschen in den USA als geheimes Signal zur Flucht, bildet einen der vielen Ankerpunkte. „Wade in the water“ wird zur Erinnerung an Widerstand.

Remi Alkhiami erzählt über Kopfhörer ihre Fluchtgeschichte. Ihre Arbeit berührt durch Stille und Reduktion – und die leise Präsenz von Verlust. Symbolisch steht auf dem Boden eine Holzschublade aus Syrien, die nur zwei Gegenstände enthält: einen Schlüssel und einen syrischen Pass. Remi erzählt, dass dieser Schlüssel für sie lange einen Garanten der Rückkehr bedeutete, als sie vor Jahren gezwungen war, ihr Zuhause in Syrien zu verlassen.

Im grauen Raum treffen zwei Arbeiten aufeinander: Razans „Walk for it“ und Lauras „Clouds II“. 2022 ging Razan auf die Straßen Hamburgs und projizierte den Satz „I can’t believe I’m still protesting this shit.” auf die Straßen und lief hinter ihm her. Für dieses Projekt hat sie 100 Fotografien aus dem Internet zusammengetragen, die handgefertigte Schilder mit dem Satz „I can’t believe I’m still protesting this fucking shit!“ zeigen – ein Spruch, der bei Protesten für Frauenrechte, Menschenrechte, LGBTIQ-Rechte und verschiedenste Befreiungsbewegungen weltweit verwendet wurde. Nach dem Sammeln der Bilder digitalisierte sie die Fotografien, schnitt den Originaltext sorgfältig aus und platzierte ihn auf farbige Hintergründe. Für Razan geht es vor allem ums Gehen, ums Lautwerden: „Ich spaziere mit all diesen Sätzen, geschrieben von Menschen, die vor mir protestiert haben. Damit zeige ich ihnen Respekt.“ Razan erzählt, dass der Satz sehr offen ist und die Leute auf der Straße zu ihr kamen und gefragt haben, wofür sie protestiere. Jede*r habe den Satz anders interpretiert. Einer dachte, sie protestiere gegen die Invasion Russlands in die Ukraine, der nächste dachte, sie demonstriere für Frauenrechte. „Jeder hat etwas Anderes gesehen. Es sind die unterschiedlichsten Diskussionen entstanden und das ist das Tolle.“, sagt Razan.
Daneben breitet sich Lauras „Clouds II“ als gewaltige Pfütze über den Boden aus. Es ist verflüssigtes Porzellan, das langsam trocknet und Risse bekommt. Auch ihre Arbeit soll eine Projektionsfläche für verschiedene Perspektiven sein und auf Transformation verweisen. Ihre zweite Arbeit, „A Dry Mouth“, lehnt daneben an der Wand und zeigt eine rötliche, organisch wirkende Masse. Bei längerer Betrachtung wirkt es tatsächlich wie ein Mund. Für Laura steht dahinter die Botschaft: „Take the stage“ – auch wenn es schwerfällt. Ein Sinnbild für das Sprechen trotz Angst.

Wasser als Metapher für Migration
Wasser zieht sich als Leitmotiv wie ein Fluss durch die Ausstellung – als Klang, Bild und Projektionsfläche. Die Künstlerinnen greifen es instinktiv auf – als Kontrast zur politischen Trockenheit. Razan analysiert kritisch das von Medien geprägte Bild von Migration, das stark mit Wasser assoziiert ist: Flüchtlingswelle, Flut, Boote. In ihrem Klangessay stellt sie die Frage: Wie sähe unser Bild von Migration aus, wenn die Medien anders berichtet hätten?
Sie verknüpft diese Sprache mit kolonialer Geschichte – etwa dem Suezkanal, einst Route des Imperialismus, heute Fluchtroute. Während Migrant*innen über Wasser nach Europa gelangen, transportieren Schiffe in entgegengesetzter Richtung Waffen. Wasser wird so zur Projektionsfläche – für Angst, Hoffnung, Macht und Widerstand.
Solidarität als gelebtes Prinzip
Kern der Ausstellung ist die Idee des Miteinanders. Solidarität erscheint nicht als große Parole, sondern als fragile, gelebte Praxis – durch Zuhören, durch Raum für vielfältige Stimmen.
Auch in der Organisation zeigt sich dieses Prinzip: Statt sich an die etablierte Kunstszene zu wenden, laden die Künstlerinnen gezielt Menschen ein, die sonst wenig Zugang zu Kunst haben – etwa aus Frauenhäusern, Selbsthilfegruppen oder Geflüchteteninitiativen. „Kunst ist für alle“, sagt Razan, „nicht nur für eine Elite.“
Die Ausstellung A Dry Mouth ist kein Erklärraum, sondern ein Erfahrungsraum. Keine fertige Botschaft – sondern ein „semi-fiktionales Rollfeld“, auf dem sich Realität und mögliche Zukünfte begegnen. Ihre Einladung: zuhören, mitfühlen, weiterdenken.
Öffnungszeiten: samstags und sonntags 14-19 Uhr
Workshop Automatisches Schreiben mit Laura Mahnke: Donnerstag 12.6., ab 18 Uhr
Finissage mit Lesungen und Performances: 15.6., ab 16 Uhr