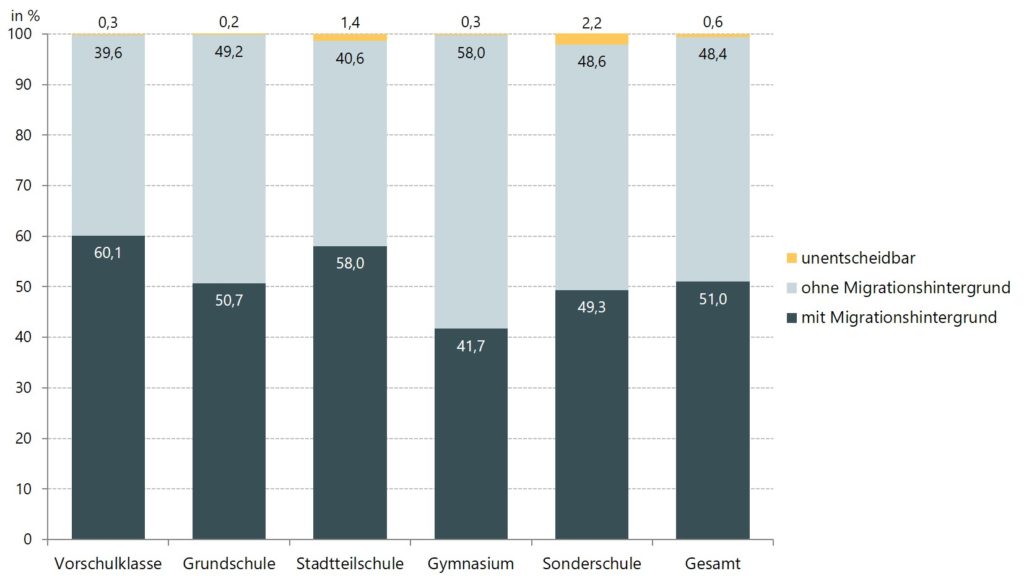“Handschlag verweigert – Libanese darf kein Deutscher werden” : so heißt ein Artikel, den die Bild Zeitung veröffentlicht hat. Zur Zeit der Veröffentlichung wurde der Fall nicht viel diskutiert. Aber als der Telegraph diesen Artikel auf Arabisch übersetzte, wurde zumindest auf der arabischen Sprache sehr viel darüber diskutiert und auch gestritten. Viele Kommentare sind dafür und viele dagegen. Unser Autor Hussam Al Zaher hat sich intensiv mit diesem Zeitungsartikel beschäftigt.
Wo fängt Leitkultur an?
In dem Fall geht es um einen Mann aus dem Libanon, der 2002 nach Deutschland einreiste, hier ein Medizinstudium machte und mittlerweile Oberarzt an einer Klinik ist. 2012 entschied sich der Mann, die Einbürgerung zu beantragen. Also nach 10 Jahren in Deutschland, wo er lebte, arbeitete und Steuern zahlte. Für die Einbürgerung hat er alle Prüfungen bestanden, er hat auch unterschrieben, den Extremismus abzulehnen und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. 2015, als er die Urkunde bekommen sollte, verweigerte er der Beamtin einen Handschlag zur Begrüßung. Nun durfte er keinen deutschen Pass bekommen, es wurde keine Einbürgerungsurkunde ausgehändigt. Zu seiner Verteidigung erklärte der Mann, dass er seiner (deutsch-syrischen) Ehefrau versprochen hatte, nur ihre Hand zu nehmen.
Seit dem ist dieser Fall vor Gericht. Am 20. August 2020 hat nun das Verwaltungsgericht des Landes Rheinland-Pfalz geurteilt: “Die „innere Einstellung“ des Mannes gewährleistet nicht, dass er sich in die deutschen Lebensverhältnisse einordne. Die Klage auf Einbürgerung wird abgelehnt, jetzt wird wohl das Bundesverwaltungsgericht mit dem Fall beschäftigt.”
Wie kam diese Meldung in den arabisch-sprachigen Communities an? Verweigert der Mann deutsche Werte? Oder ist es ein Fall von Diskriminierung seitens der Behörden? Ich kann hier nur von der syrischen Community berichten, die natürlich genau so vielfältig und unterschiedlich ist wie die Menschen selber. Trotzdem beobachte ich oft in Facebook Diskussionen, wie sich die Kommentatoren in zwei Gruppen aufteilen. Diese möchte ich etwas mehr beschreiben.
Zwei Gruppen von Syrer*innen
Eine Gruppe respektiert und akzeptiert die neue, europäische Kultur und gleichzeitig kritisiert sie ihre alte, zurückgelassene Kultur. Sie tut das nicht nur, weil sie sich in die neue Gesellschaft integrieren möchten, sondern auch weil sie an diese neuen Werte richtig glauben. Menschen, die nach dieser Gruppe kommentieren, stellen sich meistens gegen die andere Gruppe: Die konservativen Syrer*innen, die so schreiben, als wären sie noch in Syrien. Diese zweite Gruppe zeigt, dass sie nur wenig von der „neuen“ Kultur akzeptieren möchten. Sie kritisieren vieles Neue, von deutschem Gemüse bis zur europäischen Politik.
Ich weiß nicht, ob hier „konservativ“ oder „links“ die richtigen Beschreibungen sind, da wir in Syrien nicht von politischen Richtungen sprechen können, so wie hier in Deutschland. Dazu kommt, dass die Geschichte von linken Gedanken in Syrien eine sehr andere Entwicklung durchgemacht hat, als in Europa und Deutschland.
Ich schreibe also zur Einfachheit, dass die erste Gruppe sich eher links positioniert. Vor allem, wenn es um Muslime in Europa geht. Gläubige Menschen werden von dieser Gruppe als sehr konservativ gesehen. Vielleicht ist es auch so. Es könnte auch sein, dass die Menschen dieser linken Gruppe in der neuen Kultur gefunden haben, was sie brauchen, und sie sind stolz darauf. Sie haben jetzt Freiheit, Demokratie und Meinungsvielfalt gefunden. Sie sehen sich als Teil der neuen Gesellschaft und suchen Abstand zu dem Leben früher in Syrien.
Spielt hier etwas verinnerlichter Orientalismus („internalised orientalism“) eine Rolle? Vielleicht. Oder vielleicht möchten viele junge Menschen einfach nicht zur zweiten, eher konservativen Gruppe gehören. Denn viele Menschen aus dieser zweiten Gruppe zeigen nach außen, dass sie nicht ihre Gedanken verändern möchten. Sie schreiben oder sagen, dass ihre „Mutterkultur“ und Werte besser sind als die, der neuen Heimat Deutschland. So möchten sie das behalten. Natürlich ist Angst, Unsicherheit und das Gefühl von Fremdsein ein Faktor. Manche fühlen sich im Exil nicht nur fremd im neuen Land, sondern sie fühlen sich auch innerlich fremd und zerstritten.
Viel mehr als ein Handschlag
Nun zurück zum ursprünglichen Bericht und die Diskussionen auf Facebook. Zum Kontext gehört auch zu sagen, dass Facebook für die meisten Syrer*innen so etwas wie ein Community Treffpunkt, wie ein digitales Café ist. Hier treffen sich Syrer*innen aus aller Welt und diskutieren miteinander. Dabei lassen sich wie gesagt zwei Gruppen beobachten.
In dem Fall des libanesischen Oberarztes lief es so: die erste Gruppe äußerte sich für die Entscheidung, dem Mann keine Einbürgerung zu erlauben. Sie finden, dass das was die Beamtin gemacht hat, richtig war. Denn wenn Männer einer Frau nicht mit Handschlag grüßen, ist dies respektlos gegenüber den Frauen und der Freiheit. Diese Männer stellen sich gegen Integration. Deswegen dürfen sie auch keinen deutschen Pass bekommen. Und sie sagen: Wenn die Leute zwar die deutschen Werte akzeptieren, aber die deutsche “Leitkultur“ nicht, (viele neue Syrer oder Syrerinnen wissen nicht was dieser Begriff bedeutet und was hier in Deutschland damit gemeint ist) dann dürfen sie hier auch nicht leben. Sie fragen: Warum kommen diese Menschen hierher? Manche sagen sogar, dass so konservative Menschen hier nicht leben sollten.
Die Menschen der anderen, zweiten Gruppe sprechen sich natürlich gegen das Urteil aus. Sie finden, was der Mann gemacht hat, ist fair. Und sie behaupten, dass die Deutschen insgesamt eine Doppelmoral haben. Wieso haben Menschen nicht die Freiheit, nicht die Hand zu geben? Viele kritisieren auch gleich die gesamte westliche Welt, weil sie wohl gegen den Islam und gegen ihre Lebensart sind.
Beide Gruppen haben auch ihre YouTuber, Social Media Influencer und Facebook Gruppen. So wurde sehr viel diskutiert und kommentiert – aber ohne dass die meisten Deutschen das lesen oder hören werden.
Fragen und Fazit der Geschichte
Dieser Fall wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel: Wie wurde bewiesen, dass der Arzt kein Verständnis und Respekt für die deutsche Verfassung und ihre Grundrechte zeigt? Ist ein Handschlag eine kulturelle Gewohnheit oder ein Grundwert, hinter dem viele andere Werte stehen?
Ich meine, ein Gericht hätte auch die Kolleg*innen, Nachbar*innen und auch Patient*innen des Arztes fragen sollen, ob er sich gegen das deutsche Grundgesetz verhält. Oder er ist nur ein Mensch, der seine Kultur auch hier in Deutschland umsetzen möchte.
Das führt zu der großen Frage, wie viel Freiraum haben nicht-deutsche Kulturen in der deutschen Gesellschaft? Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat den Handgruß als Symbol für Leitkultur beschrieben, zufällig auch in der Bild Zeitung. Obwohl weder Leitkultur noch Handschlag im deutschen Grundgesetz erwähnt sind. Aber gehört es zu Deutschland, oder kann man diese Sache auch unterschiedlich verstehen?
Außerdem zeigt dieser Fall, dass viele Syrer*innen sehr stark und emotional auf das Thema reagieren, genau so wie wenn Deutsche darüber diskutieren. Zum Teil habe ich Kommentare von Syrer*innen gelesen, die konservativer (oder radikaler?) als viele Deutsche waren.
Ich kann diese Art zu Streiten zwischen Syrer*innen wegen dieser Geschichte gut verstehen. Und ich kenn diesen Streit zwischen nicht-gläubigen und Muslimen, oder zwischen Linken und Rechten aus Syrien. Streit ist fast immer gut, wenn sich beide Seiten nicht beleidigen, sondern offen für eine neue Perspektive sind und an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind. Aber leider ist das nicht der Fall, wenigstens nicht in den Facebook Diskussionen die ich gelesen habe. Dort wird nur für oder gegen diskutiert, es gibt keine Mitte oder Kompromisse. Auch das kann ich verstehen, weil ich weiß, wie viele Syrer*innen wie ich in einem diktatorischen System aufgewachsen sind. Viele von uns kennen es so, dass es nur eine Perspektive geben kann und alles andere war falsch, ungläubig oder ein Affront.
In diesem Fall fehlt auf vielen Seiten die Toleranz, die für mich Leitkultur ist. Wir alle sollten Toleranz lernen und umsetzen – als Syrer*innen und auch als Bürger*innen im demokratischen Deutschland.
Mitarbeit: Lilly Murmann