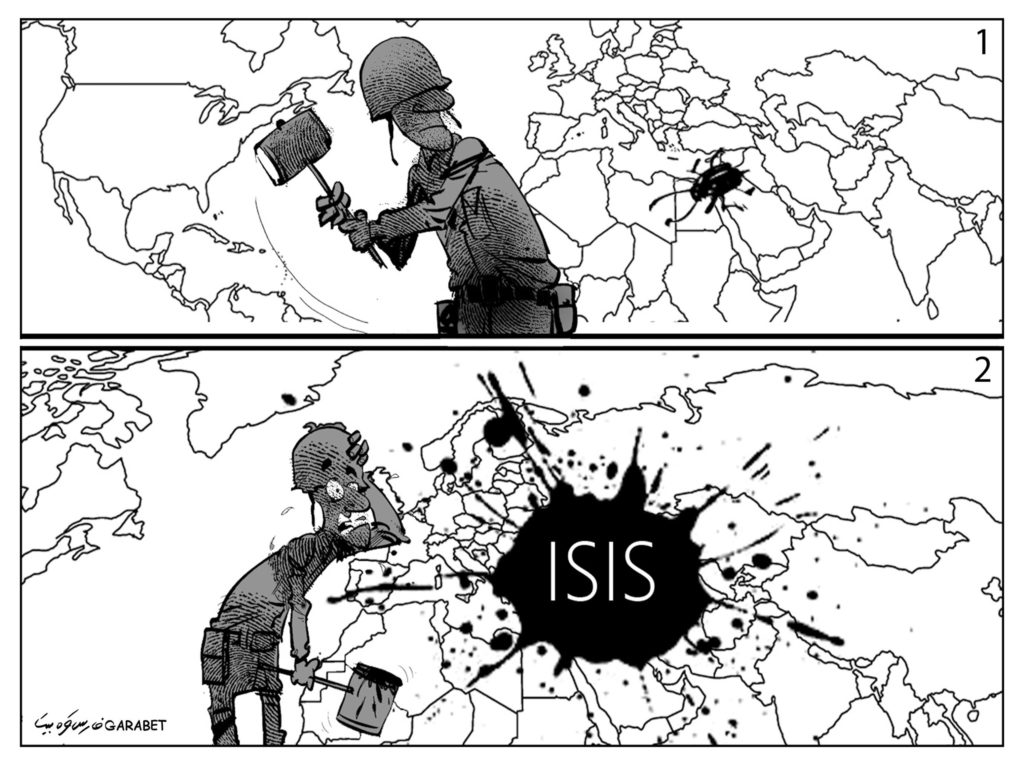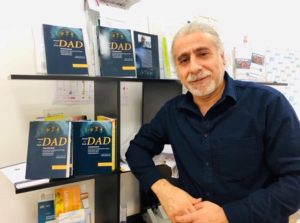Insgesamt 4634 Schülerinnen und Schüler befinden sich laut Schulbehörde momentan in Hamburg in internationalen Vorbereitungsklassen bzw. Basisklassen. Sie verfügen noch nicht über genügend Deutschkenntnisse, um dem regulären Unterricht folgen zu können. Dabei handelt es sich aber nicht nur um geflüchtete Kinder, sondern alle mit Zuwanderungshintergrund. Stephan Giese (51), Schulleiter der Billstedter Grundschule am Schleemer Park, erklärte, dass an seiner Schule auch ein Schüler aus den USA diese Klasse besuchte. „Zudem haben wir seit mindestens einem Jahr eine verstärkte Zuwanderung aus Osteuropa, Rumänien und Bulgarien zum Beispiel.“
Weiterhin Zuwanderung aus anderen Ländern
Die Schulbehörde bestätigt: „Die Zahl der Geflüchteten ist seit einiger Zeit in Hamburg rückläufig. Entsprechend wird derzeit auch die Zahl der Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) reduziert. Da allerdings nach wie vor auch viele Menschen ohne Fluchthintergrund kontinuierlich aus anderen Ländern nach Hamburg zuwandern und deren Zahl auch nicht rückläufig ist, gehen wir derzeit davon aus, dass eine bestimmte Anzahl von Vorbereitungsklassen dauerhaft bestehen bleiben muss.“
Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler besuchen zunächst für maximal ein Jahr eine Internationale Vorbereitungsklasse mit dem Schwerpunkt auf einem Intensivkurs Deutsch. Danach können die Schülerinnen und Schüler in eine Regelklasse wechseln, wo sie für weitere zwölf Monate zusätzliche Sprachförderung erhalten. Wenn Schülerinnen und Schüler gar nicht oder nicht in der lateinischen Schrift alphabetisiert sind, besuchen sie vor der IVK ein Jahr lang eine „Basisklasse“.
Übergang funktioniert „überwiegend gut“
Laut der Schulbehörde haben exemplarische Schulbesuche gezeigt, dass die Integration von neu zugewanderten Kindern in das Hamburger Schulsystem „überwiegend gut und reibungsfrei“ funktioniere. Um eine zu große Ballung von Schülerinnen und Schülern mit Sprachschwierigkeiten in einer Regelklasse zu vermeiden, sei die Zahl auf maximal vier pro Klasse begrenzt.
An der Grundschule Schleemer Park gelingt dies jedoch nicht. Am Standort Billbrook Deich wohnen alle 140 Kinder, die diese Schule besuchen, in den Wohnunterkünften Billbrookdeich mitten im Industriegebiet. Wir sind damit in Hamburg die Schule, die die meisten zugwanderten Kinder hat.“, so Giese.
Ein therapeutisches Angebot wäre sinnvoll
Der ausgebildete Sonderpädagoge feierte 2018 sein 25-jähriges Dienstjubiläum und war bereits Schulleiter in der Neustadt und hat auf St. Pauli als Lehrer gearbeitet. Er kennt sich somit mit Schulen im Brennpunkt aus. „Bei uns ist es keine Frage, ob die Kulturen miteinander klarkommen. Das liegt daran, dass wir nicht sehr viele Deutsche haben. Es ist total egal, wo wer herkommt.“
Dafür habe die Schule andere Probleme: „Wenn ein Kind eine Traumatisierung hat wie zum Beispiel durch die Flucht, dann ist das eine andere Herausforderung, das Kind zu integrieren. Das braucht psychosoziale Unterstützung.“ Aber Schulpsychologen sind nicht vorgesehen. „Wir haben Sonderpädagogen und Sozialpädagogen sowie Sprach- und Kulturmittler. Das haben andere Schulen nicht. Aber ein therapeutisches Angebot wäre wünschenswert und sinnvoll.“
Den einen optimalen Weg gibt es nicht
Stephan Giese findet zudem, dass es nicht den einen optimalen Weg gibt, um zugewanderte Kinder in der Schule zu integrieren. „Wenn Kinder erstmal für ein Jahr Deutsch lernen, finde ich das grundsätzlich gut. Das gab es früher nicht. Da sind die Kinder ganz normal in die Regelklasse gegangen und haben dort auch Deutsch gelernt. Das gelingt auch, wenn es nicht zu viele sind. Zwei Kinder mit wenig Deutschkenntnissen von 20 ist okay.“
Jetzt sind die IVK-Klassen aber fast genauso groß wie die Regelklassen. „Das ist eine sehr große Herausforderung hamburgweit. Diese Klassen sind nicht ausreichend versorgt.“ Giese wünscht sich kleinere Rahmen, um gut zu lernen. Er findet, dass höchsten zehn Kinder in einer Klasse ein gutes Modell wäre.
Die Schulbehörde hat seiner Schule bereits mehr Unterrichtsstunden zugewiesen als anderen, aber es reicht trotzdem nicht. Als Schule im Brennpunkt ist die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf besonders hoch. „Unsere Klassen sind sehr heterogen. Wir haben auch viele Kinder, die leistungsstark sind und aufs Gymnasium gehen. Gleichzeitig der hohe Anteil an sonderpädagogischem Förderbedarf.“
Gesellschaftliche Teilhabe ist wichtig
Wenn man geflüchtet und zugewanderte Kinder integrieren möchte, dann dürfen sie nicht in reinen Wohnunterkünften wohnen und schon gar nicht im Industriegebiet, sagt Giese. „Es darf auch nicht so einen Standort geben wie bei uns. Die Kinder fühlen sich wohl, keine Frage, aber es gibt keine gesellschaftliche Durchmischung und so auch nicht die Möglichkeit an gesellschaftlicher Teilhabe.“ Die Kinder seien, wenn überhaupt im Stadtteil Billstedt integriert. „Aber Billstedt ist ja auch wieder etwas besonders aufgrund seiner sozial problematischen Siedlungen.“
Stephan Giese findet, dass man bei der Frage nach der Integration der Kinder auch ihre Eltern mitdenken muss. Man solle sie nicht völlig außen vor lassen. „Wenn Eltern eine Chance bekommen, sich zu integrieren, dann fällt es auch den Kindern viel leichter.“ Sonst können Spannungen und Konflikte innerhalb der Familie entstehen. „Ein Kind probiert sich zu integrieren und Eltern können das nicht, weil sie die Sprache nicht sprechen und nicht arbeiten dürfen – also gar keine Chance haben.“
Mehr langfristige Anstrengungen sind nötig
In Punkto Bildungspolitik sei Hamburg im bundesweiten Vergleich aber trotzdem gut aufgestellt. „Aber leider reicht es trotzdem nicht. Es braucht noch mehr langfristige Anstrengungen für Schulen im sozialen Brennpunkt.“ Seinen Eindruck bestätigt der Bundesländervergleich des Bildungsmonitors 2018. Dort erreicht Hamburg Platz fünf. Laut Bildungsmonitor besteht deutliches Verbesserungspotenzial, vor allem bei der Bildungsarmut und der Integration. Viele Schüler erreichen nicht die Mindeststandards im Lesen und der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg der Kinder sei groß.
Und wie ist die Lage außerhalb eines sozialen Brennpunktes? Najmah Said (22) war ein halbes Jahr Praktikantin im Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer (KaiFu), das am Kaiser-Friedrich-Ufer im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel liegt und mit fünf einen hohen Sozialindex hat. Da Najmah sowohl Farsi als auch Deutsch spricht, war ihr schon 2015 klar, dass sie den geflüchteten Menschen helfen will. Zunächst unterstützte sie am Erstaufnahmelager am Hauptbahnhof und dann in Harburg. 2017 folgte dann das Praktikum an der Schule, wo sie selbst die Oberstufe absolvierte und 2015 ihr Abitur machte.
Einfach mal über Sorgen reden
Zusammen mit einer anderen Praktikantin begleitete sie ein halbes Jahr lang eine Internationale Vorbereitungsklasse. „Sie bestand aus 15 geflüchteten Kindern zwischen neun und 13 Jahren.“ Najmah konnten den Kindern übersetzen und ihnen erklären, was sie nicht verstanden haben und zwischen ihnen und den Lehrerinnen vermitteln, denn etwa die Hälfte der Klasse sprach Farsi. Im Laufe des halben Jahres wurde sie zu einer wichtigen Vertrauensperson.
„Alle Kinder lebten in der Flüchtlingsunterkunft und hatten nur Kontakt untereinander. Sie brauchten jemanden, bei dem sie sich aussprechen konnten. Dadurch, dass alles um sie herum dasselbe erlebt hatten, gab es niemanden, der sich einfach mal hingesetzt hat und sich ihre Geschichten und Erlebnisse angehört hat. Sie wollten auch mal über Probleme und Sorgen reden.“
Für alle eine besondere Erfahrung
Die Schülerinnen und Schüler wohnten alle in den Sophienterrassen. „Die Nachbarn dort an der Alster wollten nicht, dass da ein Flüchtlingsheim hinkommt. Dort wohnen nur wohlhabende Menschen und sie hatten Angst, dass es dort unsicher wird und haben sogar dagegen protestiert. Deshalb war der Kompromiss der Stadt, dass dort dann nur Familien wohnen und keine alleinstehenden Männer.“
„Wir Praktikantinnen haben uns auch nach der Schule mit den Kindern getroffen und gespielt. Damit sie raus kommen aus ihrer Blase.“ Aber auch die Lehrerinnen, seien nicht nur Lehrer gewesen, sondern auch die Vertrauenspersonen und die Personen, die die Normen und Sitten des Landes vemittelten. „Etwas was sonst Eltern machen.“
Najmah findet, dass die Lehrerinnen nicht darauf vorbereitet waren, dass die Flüchtlingskinder kamen: „Es war für alle eine besondere Erfahrung. Es war auch super anstrengend zwischendurch. Auf jedes Kind musstest du individuell eingehen.“
Oft fehlt im Schulalltag einfach die Zeit
Als Beispiel nennt Najmah ein Geschwisterpaar, das miterleben musste, wie die Mutter starb. Der eine Junge war so traumatisiert, dass er aufgrund seiner niedrigen Frustrationsgrenzen ständig außer Kontrolle geriet. „Da ist dann die Frage: Wie reagiert man? Die Lehrerinnen sind an ihre Grenzen gestoßen. Bestraft man das Kind dann wie alle anderen? Sie wollten die Schüler wie eine normale Klasse behandeln, aber ging nicht immer, weil die Umstände andere sind.“ Oft fehlte den Lehrerinnen auch einfach die Zeit für eine tiefgründiger Beschäftigung.
Sonja Müller, Geschichts- und Philosophielehrerin aus Nordrhein-Westfahlen (NRW), hat in ihrem Bundesland ähnliche aber auch andere Erfahrungen machen können. Dort heißen die Klassen, die auch Flüchtlingskinder besuchen, Sprachfördergruppen, sagt sie. Am Anfang nannten sie alle „Flüchtlingsklassen“. „Nach den Herbstferien 2016 standen von heute auf morgen geflüchtete Kinder vor der Tür. Es gab weder Bücher noch einen freien Raum, das musste die Schule spontan bewältigen.“
Es gibt auch Erfolgsgeschichten
Die Kinder verbrachten jeden Tag sechs Schulstunden vor Ort. „Die Altersspanne war sehr weit. Die Jüngste war 10 und der Älteste 17 Jahre alt. Manche waren nicht alphabetisiert, andere hatten in ihrer Heimat schon ein Gymnasium besucht.“ Damit die Kinder auch mit anderen Gleichaltrigen Kontakt bekommen, wurden sie dem Alter nach für Sport und Kunst den regulären Klassen zugewiesen.
Zwei Jahre lang werden die Kinder und Jugendlichen nicht bewertet, bevor sie in reguläre Klassen – gegebenenfalls auf anderen Schulen – überführt wurden. „Wir haben auch kleine Erfolgsgeschichten hier. Ein Junge macht jetzt sein Abitur und seine Schwester im nächsten Jahr“. Noch immer kommen auch in NRW Kinder, aber es ebbt ebenfalls ab. Welche Schule wie viele Kinder hat, ist auch nicht immer gleich. „Ich kenne Schulen, die haben gar keine. Wir hier haben Glück gehabt. Es sind nicht zu viele, wir können uns gut kümmern. Richtige Problemfälle gab es auch nicht, aber ich weiß, dass wir damit eine Ausnahme sind“.
Eltern spielen eine wichtige Rolle
In der Region Hannover wurde sogar extra eine Integrierte Gesamtschule (IGS) gegründet. Magret Kerst (59) arbeitet dort in einer 20.000-Einwohner-Gemeinde, um dort auch Kinder zu unterrichten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Nach einem Jahr Sprachklasse, haben immer zwei bis fünf Schüler an der IGS in den regulären Klassen mitgelernt. Auch dort ebbt der Andrang der Neuzugänge ab, so Kerst.
Die Schule ist grundsätzlich inklusiv und auch auf Kinder mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen ausgerichtet. „Die Experten von der Traumabehandlung vom Schulpsychologischen Dienst haben dringend davon abgeraten, dass wir als „Hobbypsychologen“ uns mit den Kindern auf diese Art beschäftigen.“ Ähnlich wie Stephan Giese in Hamburg beklagt auch Kerst, dass mehr Stunden und Betreuung für die Kinder nötig gewesen wären. „Ich persönlich hätte auch gerne Ausflüge mit ihnen unternommen.“ Auch Kerst erkennt die Rolle, die Eltern spielen können. „Sind sie gut gebildet, dann profitieren die Kinder davon“
Manche geben auf, wenn sie keine Erfolge haben
Christine Simon-Noll arbeite bei der Flüchtlingshilfe Hafencity in Hamburg, steht im regen Kontakt mit Flüchtlingskindern und gibt ihnen Nachhilfe. Sie bestätigt, was viele Lehrer beklagen: Die Kinder erzählen oft, dass sie in den Schulen nur mit anderen geflüchteten Kindern Kontakt haben und keine Freundschaften zu Kindern schließen, die in Deutschland aufgewachsen sind.
Manche Kinder geben auf, wenn sie schlechte Noten haben und keine Erfolge haben. Manche sind aber auch sehr ehrgeizig und bitten immer wieder um Hilfe. Sie brauchen mehr Unterstützung. Die Schule kann nicht genug leisten und die Flüchtlingshilfe kann es auch nicht alles auffangen.“ Auch Simon-Noll bemerkt, welchen unterschied der Bildungshintergrund der Eltern macht.
Schulen nicht allein lassen
In Deutschland sind der Bildungserfolg und die berufliche Laufbahn abhängig von den sozialen Faktoren. Das zeigt auch die neuste Studie Berechnung der sozialgruppenspezifischen Bildungsbeteiligungsquoten vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Stephan Giese, Schulleiter der Schule am Schleeme Park, hat dazu eine klare Meinung und einen Appell an die Bildungspolitik: „Schule kann nicht der Ort sein, an dem soziale Ungerechtigkeit alleine gelöst wird. Das überfordert Schulen. Sie kann mitarbeiten, aber nicht alleine. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, finde ich, und da müssen auch alle anpacken und die Politik muss mehr tun.“